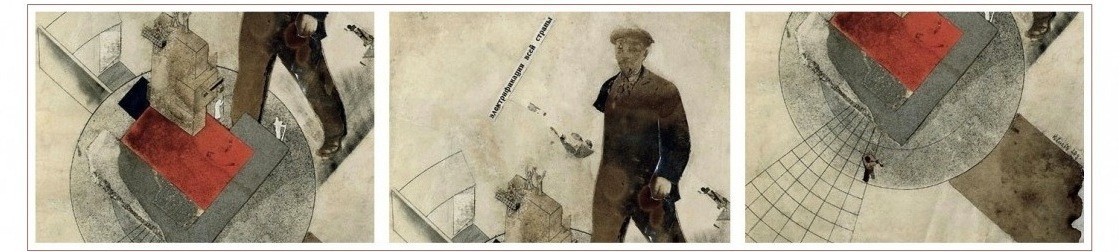Denn Diskursführen — [..] – heißt das nicht:
den anderen auf den Geist gehen? (Roland Barthes)
Die philosophische Rede ist dadurch gekennzeichnet,
dass sie sich grundsätzlich ab einem bestimmten Punkt
verliert; ja, sie ist vielleicht selbst gar nichts anderes als
ein unerbittliches Verlieren und Sich-Verlieren. (Maurice Blanchot)
Un(aus)haltbarer Diskurs
I
Im Rahmen eines die Vorlesung Wie zusammen leben? begleitenden Seminars zum Thema Was heißt: einen Diskurs führen? Untersuchungen über das besetzte Sprechen (1977), das der Einschüchterung (l´intimidation) durch Sprache gewidmet ist, die er andernorts, in der kurz zuvor gehaltenen Antrittsvorlesung im Collège de France, Foucault überbietend und, in einer Gewaltsamkeit unaushaltbar unverhohlen den konstativen Inhalt der These beinahe performativ belegend, als faschistisch bezeichnet [*],
Sprechen – und noch viel mehr einen Diskurs führen – heißt nicht kommunizieren, wie man allzu oft wiederholt, es heißt unterwerfen: die gesamte Sprache ist eine verallgemeinerte Rektion. (…) Doch die Sprache (langue) als Performanz aller Rede (langage) ist weder reaktionär noch progressiv; sie ist ganz einfach faschistisch; denn Faschismus heißt nicht am Sagen hindern, er heißt zum Sagen zwingen. (…) In der Sprache verschmelzen also unvermeidlich Unterwerfung und Macht.“ (Roland Barthes, Leçon/Lektion, 17ff.)
stellt Roland Barthes folgende zwei Punkte heraus, um — Tragweiten des für die Ostentation entscheidenden und unverkennbar mit einer gewissen Erektilität assoziierten Haltens (tenir) und Spannens (tendre) auslotend — die Bedeutung von tenir un discours zu beschreiben:
1. Ein Streben nach Kraft, Zwang, Unterwerfung;
-eine Dauer, eine Beharrlichkeit;
– eine Spannung, eine gespannte, systematische Festigkeit. (une tension, une consistance tendue, systématique. )
Anders gesagt: ein Streben nach Totalität, Ewigkeit, Sein.2. Eine theatralische Wirkung: durch den Diskurs als ostentative Vor-Führung eines Sprechens + „halten“, einen Ort besetzen, der nicht der eigene ist. Eine Rolle spielen -> einen Diskurs führen=eine sprachliche Maske tragen. (Tenir un rôle -> tenir un discours = tenir un masque langagier.)
Kann die immer einschüchternde und unterwerfende Rede in ihrem bezwingenden Charakter selbst, wenn nicht bezwungen, so doch in ihrem sich verfestigenden, (sich) in sich einschließen wollenden Totalisierungsgebaren, ihrem Turmbau, gelöst und zerstreut werden, dann durch die Listen und Finten dessen, was zunächst Literatur genannt wird und in deren „auf die Sprache wirkenden Arbeit des Verschiebens (travail de déplacement)“ besteht,
Dieses heilsame Überlisten, dieses Umgehen, dieses großartige Lockmittel, das es möglich macht, die außerhalb der Macht stehende Sprache in dem Glanz einer permanenten Revolution der Rede zu hören, nenne ich: Literatur. (Leçon/Lektion, 23.)
im späteren Passus allgemein der Abschweifung zugeschrieben wird. Als Antidot gegen den Diskurs, aus ihm selbst heraus, erweist sich der den Diskurs erschöpfende Exkurs:
Da dieser Unterricht, wie ich anzudeuten versucht habe, den in der Zwangsläufigkeit seiner Macht erfassten Diskurs zum Gegenstand hat, kann die Methode nur auf die Mittel gerichtet sein, die geeignet sind, diese Macht zu durchkreuzen, sich von ihr zu lösen oder sie wenigstens zu vermindern. Und ich bin mehr und mehr überzeugt, dass , sei es beim Schreiben, sei es beim Unterrichten, die grundlegende Operation dieser Methode des Lösens (méthode de déprise), wenn man schreibt, in der Fragmentierung, wenn man darlegt, in der Abschweifung besteht, oder, um es mit einem preziös mehrdeutigen Ausdruck zu bezeichnen: in der Exkursion.
Aber wie verläuft der errante Kurs des „Diskurs“ überhaupt, wie kommt er, als Lexem und Dispositiv, zu Stand, wie hält er sich aus und durch, um dann im Theorietheater lang genug die altbekannte Hauptrolle zu spielen?
II
Ausgehend vom zunächst orientierungslos-irrenden Auseinanderlaufen oder Umherrennen und ausgiebig erkundenden, weitschweifigen Sich-Ergehen (discourir kann im Französischen heute noch das Schwatzen und Schwadronieren, sowie das Redenschwingen heißen), mithin einer gewissen, aus vorgängiger Umtriebigkeit sich speisenden „Läufigkeit“,
Discursus, c´est originellement, l´action de courir ça et là, ce sont des allées et venues, des ‚démarches‘, des ‚intrigues‘ (Roland Barthes, Fragments d´un discours amoureux, Paris 1997)
stellt das Wort „discours(e)/discorso“ in den romanischen Sprachen wie im Englischen vor allem, so heißt es, auf sich raumgreifend ausbreitende sprachliche Bekundungen ab: Ansprachen oder Gespräche mit und über.
In der frühen Neuzeit (Descartes, Galilei, Leibniz, Rousseau) vereindeutigt es — die Richtungslosigkeit dieses unruhigen Unterwegs mehr und mehr mit Methode (und also mit hodos, zur planierten via regia gedeutet) zielführend ausrichtend [1] — zu einem Terminus, der schlechthin jede Form des themengebundenen, erörternden Vortrags, der mehr oder weniger elaborierten theoretisch traktierenden Abhandlung, eventuell mit dem gelehrten Anspruch erschöpfender Umfassendheit, bedeuten kann. Ganz allgemein, dass über eine vorgeblich außersprachlich schon vorliegende Fragestellung oder einen Sachzusammenhang, mündlich oder schriftlich, gesprochen wird und wie, wobei dieses Wie, der Modus, und wieweit er Moden unterliegen soll, darf oder muss, seinerseits Problempotential birgt.
III
Kants Begriff des Diskursiven nun ist Begriff fürs Begriffliche. Als Gegenbegriff zum Intuitiven — fürs Deutsche prägende Entlehnung des weitgehend mit ratiocinatio, dem Schlußfolgern gleichbedeutenden discursus von Wolff und Baumgarten –,
weil die spezifische Natur unseres Verstandes darin besteht, alles diskursiv, d.i. durch Begriffe, mithin auch durch lauter Prädikate zu denken (Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, §46)
sieht er sich in der Notwendigkeit eines verstehenden Verstandes, auf Begriffe und deren Verknüpfungen zu rekurieren und nicht in einer immediaten Anschauung alles unverstellt auf einmal zu haben oder geben, sehr bald mit manifesten Fragen der Darstellung, der Präsentation, der Exposition seines Lehrgebäudes konfrontiert. Wie weit hat solche schriftliche (Re)Präsentation pädagogisch, populär, stilistisch reizvoll zu sein (oder gerade nicht), um dem Darzustellenden gerecht zu werden? Denn genau besehen ist dies Darzustellende (das System), nichts anderes als seine Darstellung; und gleichzeitig auf perfide Weise — nicht. Was nun, wenn letztere, die Darstellung, nie zureichend wäre, die erforderte Synthese nur in fortwährender Trennung (und also in gewisser Weise — nicht) herstellen könnte? Das heißt, mit einer und als Synkope, von der man sagen kann, dass sie medizinisch verstanden als Ohnmacht und Bewußtlosigkeit, musikalisch als der Ausfall einer erwarteten Betonung auf üblicher Zählzeit die Kehrseite der Medaille der transzendentalen Synthesis ausmacht, die wie das cogito ihrer selbst erst gewahr wird, wo sie sich verfehlt (ein cogito, das im Übrigen ganz ähnlich wie der discursus im co-agitare nicht zwingend wie Augustinus will [2], auf ein Zusammenlesen deuten muss, sondern auch, „läufiger“, das Umher- und Zusammentreiben z.b. einer Herde meinen kann). Das System, die Synthese=die Synkope, ein im Ausfall sich gewahrender Einfall, das heißt, der Diskurs als unentwegter Exkurs seiner selbst.
Man müßte die mittelalterliche Bedeutung von discursus, insbesondere in der Scholastik nachschlagen: eine interessante Karteikarte, die ich verloren habe, doch ich erinnere mich an die Bedeutung von Abstand, Bruch (Roland Barthes)
[Barthes Gedächtnis-Synkope bricht hier und rückt ab von der gängigen Einsicht, bereits bei Albertus Magnus, Duns Scotus und Thomas von Aquin sei discursus mit der schlußförmigen Verstandestätigkeit assoziiert.]
Le discours philosophique toujours se perd à un certain moment : il n’est peut-être même qu’une manière inexorable de perdre et de se perdre. (Blanchot.*)
In einem der wenigen pathetisch-appelativen Absätze seines Le Discours de la syncope (original: Paris: Aubier-Flammarion, 1976, im selben Jahr somit wie Derridas Glas), Teil 1 Logodaedalus, das jetzt mit dem Titel Synkopenrede die klanglichen Anspielungen auf den Discours de la Methode Descartes wie sämtliche postmodernen und – strukturalistischen Verwendungen des Wortes von Foucault bis Habermas fallen lässt, um semantisch die Fragen der adäquaten Darstellung eher auf die gediegene rhetorische Kategorie der „Rede“ zu verlegen, heisst es über eine bestimmte Kant-Krise in der sich die Theorie sich selbst als Frage nach ihrer Möglichkeit (der Veranschaulichung von Begrifflichem) gegenüber gestellt sieht, genauer die Fragen“
„Wie ist die Philosophie darzustellen?“ und „Was hält das System zusammen?“ (der zweiten sollte sich der nie erschienene zweite Teil der Studie, „Kosmotheoros“, widmen)
auf die Kants Antwort die Unentscheidbarkeit sein soll,
wie folgt:
„Die Philosophie war sich immer schon darüber im Klaren, dass sie etwas Unhaltbares an sich habe: gerade deshalb verleugnet sie es und gibt vor zu wissen und zu denken. Sie gibt sogar vor, dasjenige zu bedenken, was an ihr selbst unhaltbar ist. Das also ist der Grund dafür, dass sie sich aufregt und ihre Rede angesichts dieser „kantischen Wirkung“ zittern macht (wer nicht zittert, ist kein Philosoph, sondern vielmehr ein Ideologe der Philosophie, ganz gleich, ob er sich dabei als ein Bewahrer, Erneuerer oder Zerstörer der Philosophie ausgibt). Wer nicht gewillt ist, diese Erschöpfung der Rede bis zum Äußersten zu treiben, hat keinen Grund, sich mit der Philosophie zu befassen. Nur wenn die Philosophie derart an ihre Grenzen gebracht wird, kann sie ihr Glück versuchen. Dabei geht es nicht etwa um irgendein „Interesse“, sondern um einen Befehl, eine Vorschrift, jenes seltsame „Du sollst reden“, von dem eine Kultur ihre ganze Geschichte hindurch zehrt, um sich dadurch zugleich zu erschöpfen.“
Cet étrange tu dois discourir…Das heißt auch: Man muss, seltsamem und befremdlichem Imperativ folgend, schwätzen und schwadronieren, in scheinbarer Selbstdarstellungswut eine Rede halten und dem anderen (mitsamt dem, was Barthes die Einschüchterung/l´intimidation durch Sprache nennt) aufnötigen und damit immer schon, ist das Ideal auch das eines — den „Philosophen“ nur als eine Figur auswerfend, die sich zurücknimmt —
Der Philosoph ist mithin kein Logodaedalus oder muss es doch wenigstens nicht sein. [3]
stillosen Stils, der nur der Sache, nicht der Gefallssucht und Spielerei gefällig ist, sich mit dem verschworen zeigen — einer gewissen literarischen Weitläufigkeit wie einem wortdrechselnden Manierismus — was es an sich doch zu meiden gilt. Auf der Suche nach „schlichte[r] Prosa-Erhabenheit“ bis zur Erschöpfung.
Im Zwang sich auszubreiten und umfassend zu erklären, verlieht sich das Selbst der Sache, die es zu schildern geht, im gleichen Zuge, wie es sich zu etablieren und konsolidieren trachtet.
Wie ein Diskurs zu halten sei, welcher Darstellungsmittel man sich zu bedienen habe, um eine Sache adäquat auszudrücken, wenn die Sprache ein Nach- und stetig teilendes Auseinander, in diesem stetig von sich abrückenden Verfehlen allein Trefflichkeit ermöglicht und nicht wie die geometrische Zeichung ein mit einem Blick auf einmal der Anschauung vorlegbares Zugleich verstattet, fällt dann zusammen mit einer anderen Bedeutung des Führens und Haltens (tenir), die Herstellung von belastungsfähiger Haltbarkeit: Wie wird das Dargestellte konsistent, kohärent und als beständiges, tragfähiges Gebäude einsturzsicher errichtet? Ist die Errichtung (und Schließung) des architektonisch im Auf- und Grund-Riß skizzierten „Systems“ aufgrund des Erfordernisses sprachlicher Verfasstheit — die in ihrer Ausbreitung den Augenblick der Vollendung stets vor sich herscheibt und im Fortschreiten das Zustande gekommen jeweils immer auch wieder zersetzt — nicht prinzipiell unmöglich und allenfalls als regulative Idee vorstellbar?
Dass Kant, der doch (so jedenfalls stellt es Heidegger in „Der Satz vom Grund“ dar) dem versichernd zureichende Gründe zustellenden Leibnizschen principium rationes reddendae sufficientes ganz und gar verpflichtet war im Versuch die Gegenständigkeit des Gegenstands in der transzendentalen Apperzeption zu verankern, besonders unter der alle Architektonik instabilierenden Notwendigkeit auf sprachliche Darstellung laborierte, zu der er in sich selbst immer wieder, halb kokettierend, eine Unfähigkeit und eine Mangel an Talent diagnostizierte, nimmt Jean-Luc Nancy so in den Blick, dass sie sich auf das Verhältnis der Philosophie zur Literatur hin zuspitzt. Dieses erscheint als ein Selbes, von dem gesagt werden kann, es sei nicht einer äußerlichen Alterität entgegengesetzt. Im Gegenteil: Es unentscheidet, indezidiert sich, entsteht aus dem Zusammenfall von blindem Fleck und Zentrum des Sehfeldes:
Das Unentscheidbare ist die Selbigkeit des Selben, die durch das Selbe als seine Veränderung hervorgebracht wird.
Das Unentscheidbare resultiert vielmehr aus einem genauen Übereinanderlegen – in der Geometrie würde man hier von einer Homographie sprechen – des blinden Flecks und des Sehzentrums. Eine unentscheidbarer Satz ist ein Satz, der nicht zum Gegenstand eines Beweises gemacht werden kann: weder indem man ihn aus einem System ableitet noch indem man ihn davon ausschließt; er ist weder herleitbar noch widerlegbar; er unterwirft sich nicht der Logik eines Systems, tritt jedoch zugleich in keinen Gegensatz zu ihm (da er ihm angehört). Bekanntlich hat Gödel bewiesen, dass es in einem formalen System jederzeit möglich ist, eine unentscheidbare Äußerung zu konstruieren – dass es also grundsätzlich unmöglich ist, über die Gültigkeit eines Systems zu entscheiden, seine Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit von ihm selbst her zu erweisen. Doch es kommt hier nicht auf die Niederlage des mathematischen Selbst-Beweises und die dadurch hervorgerufene metaphysische Wehmut an. Wichtig ist dabei vielmehr der Selbst-Beweis der Niederlage, wenn man so sagen darf. Der unentscheidbare Satz wird durch das System und in ihm selbst hervorgebracht, bezeichnet und eingeordnet.
In der Abwehr von Literarizität und Stil, geschweige denn Manierismus, verdunkelt Kant sein wahres Begehren elegante und gefällige Prosa zu komponieren, gibt es — und den Logodaedalus, der er ist und dem er folgt —
In gewisser Weise macht diese einzigartige Logodaedalie Kants „ganze Philosophie“ aus.
derart aber überhaupt zu erkennen.
Der Logodaedalus, jener ach so oft angeprangerte Wortschöpfer ist somit niemand anderes als Kant selbst, der Schriftsteller-Philosoph – Schriftsteller, weil Philosoph. Das wiederum lässt sich wenigstens auf zwei Weisen denken: entweder ist Kant im Gegensatz zu den Scharlatanen aller Art und Profession ein Logodaedalus im guten Sinne, also einer, der seine Worte aus reinen Elementen bezieht und zusammensetzt; dagegen spricht freilich, dass die kantische Lehre nirgends mit einer Sprachtheorie aufwartet, einer Theorie der Reinheit oder Ursprünglichkeit der Sprache, die dem Denken einer „langue bien faite“ Raum böte; andernfalls aber kann Kant nichts anderes sein als ein Logodaedalus im üblen Sinne, ein Schöpfer hochtrabender und glänzender Worte, ein Witz- und Schleiermacher. Wahrscheinlich – so es denn einen Sinn hat, sich hier auf Wahrscheinlichkeiten zu berufen – ist er weder bloß das eine noch auch bloß das andere, vielmehr beides, beides zugleich; dieser „selbe“ Logodaedalus nun zeichnet sich zunächst einmal dadurch aus, dass er das Wort „Logodaedalus“ prägt oder es wenigstens doch erneuert, indem er mit seinem Schullatein wie zufällig ein Wort aufgreift, das Platon zur Bezeichnung eines byzantinischen Redners braucht. Kant bringt somit noch einmal den unentscheidbaren Streit oder Wettstreit zwischen Platon und den Sophisten zur Aufführung. Er steht selbstverständlich aufseiten des Philosophen, aufseiten Platons; nur steht Platon in dieser Wiederholung auf der Seite von Logodaedalus …. Indem er dieses Wort – „Logodaedalus“ – erneuert und seinen Text mit diesem Witz* unterzeichnet, bringt es Kant auf einen Schlag dahin, dass Literatur und Philosophie voneinander gesondert und miteinander vermischt werden; dabei stellen beide füreinander zugleich die tiefste Bedrohung und die größte Verlockung dar.
Und öffnet damit die Ontologie für die keine separate wahre Wirklichkeit bloß illustrierende Exposition der Schrift und des Schreibens.
Die Frage nach der „Literatur“ bleibt in gewisser Weise eine äußerliche, hier und da verstreut und ohne echte Auswirkung auf die Frage nach dem Schema – was dem Faktum entspricht, dass es Kant in seinem Willen zum System nicht gelingt, sich gegenüber dem eigenen Text zu behaupten. Die Scheidung von Logodaedalus und Kosmotheoros resultiert aus etwas wie einem thematischen Bruch und der Unfähigkeit, beide zusammenzuführen – eine Synkope in der Arbeit. (S.7)
Damit auch ent-schließt sich, durch allen Rigorismus des Willens zur Sprache marginalisierenden architektonischen Systematizität hindurch, die diskursive Rationalität zu einer Unhaltbarkeit der Erprobung (vielleicht der von Hannah Arendt „Denken ohne Geländer“ genannten Erfahrung und Exkursion), der sich auszusetzen sie in den Augen Nancys seither, und trotz der zeitlosen Mode akademistischer Restauration, nicht aufgehört hat.
Wer wäre so naiv, die Rede der Synkope halten zu wollen? Das Festhalten am Unentscheidbaren führt immer zu Erschöpfung und Verzweiflung, was durchaus nichts Dramatisches an sich hat (es könnte uns vielmehr zum Lachen bringen). Und doch: wer wollte es aufgeben? […] Wer nicht gewillt ist, diese Erschöpfung der Rede bis zum Äußersten zu treiben, hat keinen Grund, sich mit der Philosophie zu befassen.
Was bleibt bei allem erschöpfenden Sich-Verlieren der Rede an die Unangemessenheit und dem Lachen, das diese Inadäquation (im Gegensatz zur durchaus nicht unumgänglichen tragischen Verzweiflung) erregen kann (es ist dem Niesen ähnliche Erschütterung und ununterscheidbar vom Erhabenen) ist
die Notwendigkeit zu schreiben, und also: Zeichen zu setzen (wie? Be-zeichnen meint vielleicht gar nichts anderes als: verunentscheidbaren) im Zwischen von Philosophie und Literatur, zwischen der Philosophie und ihr selbst. Was schließlich geschrieben steht ist weder hier noch dort und vermutlich doch auch nirgends anderswo.
Informationen zum Buch
[*] „Barthes’ gewagte Behauptung in seiner Antrittsvorlesung im Collège de France im Jahr 1977, die Sprache sei »faschistisch« (»la langue est fasciste«), hat sein Ansehen in den Augen von Philosophen und militanten Theoretikern beschädigt.“ So seine Biographin Tiphaine Samoyault. Dass die Sprache weder bloß informativ noch bloß kommunikativ im „neutralen“ Sinne ist, sondern in-formiert und die die communitas über redundante Anordnungsworte in Übereinstimmung mit sich selbst zu bringen versucht, unterstreichen Deleuze und Guattari: „Anstatt den gesunden Menschenverstand zu definieren, also das Vermögen, das die Informationen zentralisiert, sollte man eher jene scheußliche Fähigkeit definieren, die darin besteht Befehle [mots d’ordre] auszugeben, zu empfangen und zu übermitteln. Die Sprache ist nicht einmal dazu da, um geglaubt zu werden, sondern um zu gehorchen und Gehorsam zu verschaffen.“ (Deleuze / Guattari: Tausend Plateaus, S. 106.). Sie befinden sich in dieser Hinsicht, der Bestimmung der Sprachverwendung als gemeinschaftsstiftende Befehlsübermittlung, — wenn auch nicht mit dessen naturrechtlichen Prämissen –, in Übereinstimmung mit Hobbes, für den „die größte Wohltat der Sprache [ist], daß wir befehlen und Befehle verstehen können. Denn ohne diese gäbe es keine Gemeinschaft zwischen den Menschen“ (Thomas Hobbes: Vom Menschen – Vom Bürger. Eingeleitet und herausgegeben von Günter Gwalick, auf der Grundlage der Übersetzung von M. Frischeisen-Köhler, die von Günter Gawlick berichtigt wurde, zweite verbesserte Auflage, Hamburg 1966, S. 17.)
[1] Gleichwohl zeigt sich etwa schon am Beispiel von Descartes Discours de la méthode, dass der discursus mit der Methode nicht ineins fällt, sondern, in seinem Fall, eher der Suchbewegung nach ihr entspricht. Unterwegs zum Weg, wie auch die Methode (meta+hodus) nicht bereits der Weg ist, sondern nur der Weg zum Weg, mithin die Anleitung, ihn — die Ordnung und Regularität- überhaupt erst, ausgehend vom Exodos, hintern den es kein Zurück gibt, zu finden.
[2] „Und wieviel Derartiges trägt mein Gedächtnis, was schon aufgefunden ist und wie ich sagte, gewissermaßen handlich gemacht ist, wovon man sagt,
wir hätten es gelernt und kennten es. Wenn ich ablasse, es in mäßigen Zwischenräumen von Zeit zu Zeit ins Gedächtnis zurückzurufen, so taucht es wieder unter und verliert sich sozusagen in die inneren Gemächer, so daß es, als wäre es etwas Neues, von ebendaher wiederum auszudenken (denn es gibt dafür keinen andern Bereich) und wieder zusammenzubringen ist, so daß man es wissen kann, das will sagen, daß es wie aus einer gewissen Zerstreutheit zu sammeln ist, von wo es auch seinen Namen erhalten hat: cogito, d. i. »zusammendenken«, »durch wiederholtes Denken zusammenbringen«. Denn die Worte cogo [versammeln, vereinigen und zusammenbringen, aber auch erzwingen und nötigen; aufhäufen; einnehmen, einsammeln, ernten] und cogito, das ist »ich denk« und »ich denke wiederholt«, sind ebenso wie die Worte ago [forttreiben, -führen, -reißen; rauben] und agito, d. i. ich handle und ich handle wiederholt, oder wie facio und factito, ich tue und ich tue wiederholt. Dennoch hat der Geist dies Wort für sich in Anspruch genommen, so daß nicht, was anderswo, sondern was im Geiste gesammelt wird, d. h. wiederum gedacht wird, schon im eigentlichen Sinne cogitari genannt wird.“ / „et quam multa huius modi gestat memoria mea, quae iam inventa sunt, et sicut dixi, quasi ad manum posita, quae didicisse et nosse dicimur: quae si modestis temporum intervallis recolere desivero, ita rursus demerguntur et quasi in remotiora penetralia dilabuntur, ut denuo velut nova excogitanda sint indidem iterum — neque enim est alia regio eorum — et cogenda rursus, ut sciri possint, id est velut ex quadam dispersione colligenda, unde dictum est cogitare. nam cogo et cogito sic est, ut ago et agito, facio et factito. verum tamen sibi animus hoc verbum proprie vindicavit, ut non quod alibi, sed quod in animo colligitur, id est cogitur, cogitari proprie iam dicatur.“ (Augustinus, Confessiones, 10.11)
[3] Das Wort, das einmal bei Kant auftaucht, steht damit in einem interessanten Zusammenhang mit der unmöglichen Abwehr von Sophistikationen, die Kant an anderer Stelle, im Herzen der Vernunft selbst verortet hat: „Es sind Sophistikationen, nicht der Menschen, sondern der reinen Vernunft selbst, von denen selbst der Weiseste unter allen Menschen sich nicht losmachen, und vielleicht zwar nach vieler Bemühung den Irrtum verhüten, den Schein aber, der ihn unaufhörlich zwackt und äfft, niemals völlig loswerden kann.“ http://gutenberg.spiegel.de/buch/kritik-der-reinen-vernunft-1-auflage-3508/63