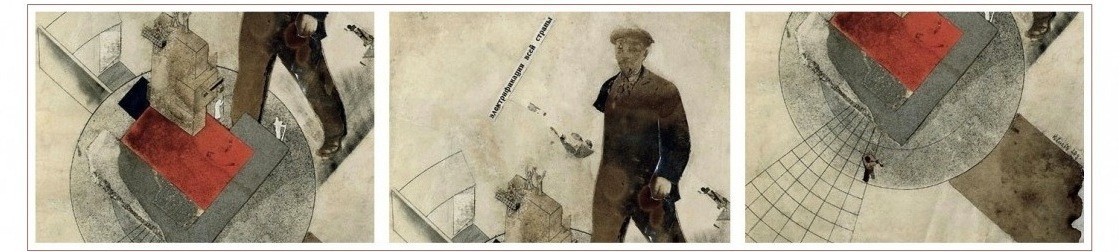Entrée. Man muss sich einlassen
Der Anfang liegt nahe
Was China betrifft, frage ich mich sogar: Ist es überhaupt nötig, dass wir mittels Fragen denken? Heißt Denken immer, ein Rätsel zu beantworten, die Sphinx zu befragen, den Abgrund auszuloten, wie es im Abendland seit den Griechen mit großer Leidenschaft gewollt wurde?
Wird Zugang zum schlechthin Anderen gesucht, das, inkommensurabel heterogen, emphatisch ein solches wäre und nicht bloß weitere Variante des Selben, liegt bisweilen nahe, genealogisch oder archäologisch verfahrend, mit dem Anfang zu beginnen, der es eröffnet und auf den Weg bringt.
Kann man überhaupt anders anfangen als mit dem <Anfang>?
Umso mehr, wenn unterstellt wird, und das tut Philosoph und Sinologe Francois Jullien in seinem Essay Denkzugänge. Mögliche Wege des Geistes – er plausibilisiert besagte Behauptung an Eröffnungssätzen aus der Romanliteratur – dieser, der Anfang, enthalte bereits, in seinem Inhalt und idiomatischen Duktus, alles Folgende in nuce in sich verkapselt. Gäbe eine Richtung vor; bringe etwas auf den Weg, das, einmal ins Rollen gekommen, nicht mehr aufzuhalten ist. Für seine kleine Propädeutik wird Jullien sich deshalb, initial und intitiatorisch, des mit dem Anfang beschäftigten ersten Satzes (der keiner ist, sondern eher eine parataktische Serie) des I-Ging, des Klassikers der Wandlungen bedienen, den er umfangreich auslegt, einen Kommentar dazu kommentierend, und übersetzt. Es handelt sich, nach den Ausführungen Julliens, um einen Anfang, in dem nichts (schon gar kein Subjekt) handelt, sondern Anfänglichkeit selbst als initiatorisches Vermögen benannt wird, Ingangsetzung einer Operativität, die sich als solche erhält und zu keinem Ende gelangt. Verfasst im binären Strichcode und dabei von einer Originalität, die, nach Jullien, vor allem darin besteht, gegen jegliche Originalität sich zu verwahren.
Glücklicherweise geht es in diesem Fall nicht darum, das chinesische Denken umfassend zu „kennen“, ein unendliches Unterfangen, für das zwei Leben nötig wären; sondern um etwas ganz anderes: lediglich darum, eine Schwelle zu überschreiten, einen Weg zu bahnen, sich „einzulassen.“
Es geht folglich um etwas ganz anderes: anders zum Anderen dieser Anfänglichkeit, die Prozesshaftigkeit, Operativität, Gangbarkeit und Regulation eröffnet, zu gelangen. Ein insistenter Imperativ, der nicht aufhört innerhalb des Buches seine unerbittliche Forderung zu reklamieren: das wirkliche Sich-Einlassen aufs Anderswo „China“ ist nötig; dazu sind Historie und Klassifikationen, „Abriß, Extrakt, digest“, wenn nicht ungeignet, so doch oft nur Alibis, um der wahrhaft herausfordernden Konfrontation auszuweichen. Genauso der Zweifel: sein vermeintlich so grenzenloser Verdacht, dem bislang für wahr Erachteten gegenüber, richtet sich ein auf dem Fundament von Unbestreitbarkeiten, die ihrerseits der Infragestellung gerade für immer entzogen bleiben müssen. Und dennoch als implizite Voraussetzungen das Ausgesparte bleiben, das wohl sich einzig zu denken lohnte. Man wird sich, soviel ist im Vorhinein sicher, bei alldem, nicht eingelassen haben. Jullien weiß eine Vielzahl von Arten und Weisen aufzuzählen, sich nicht einzulassen. Nein, sich wirklich einlassen müsste all dem gegenüber im Kontrast sein wie einer Bruderschaft beizutreten; es geht nicht ab ohne eine gewisse Komplizität mit dem Anderen und die Bereitschaft loszulassen und die eigenen Ausgangskategorien aufzugeben. Ein Abstand muß eingeführt werden, der das Eigene von sich selbst trennt und in dieser Distanznahme „uns nicht nur über unsere Fragen nachdenken lässt, sondern mehr noch über das, was sie möglich gemacht hat und uns so sehr an sie bindet, dass wir sie für notwendig halten.“
Sich auf das chinesische Denken einzulassen, heißt also damit zu beginnen, sich von dessen Blickpunkt aus zu hinterfragen, gemäß dessen impliziten Voraussetzungen und dessen Erwartungen. […] Wir werden uns in Europa nicht mehr auf den Horizont europäischen Denkens beschränken können.
Bei allen faszinierenden Ausführungen zu jener Anfänglichkeit vermag jedoch die heuristisch-hermeneutische Dimension des Herangehen die meiste Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Sie ist umständlich, subtil und besonnen. Alles in allem erinnert die tastende Suche nach einem anderen Anfang als Anfang eines anderen (und eines anderern Anderen) an Heideggers Vorsokratikerexegese; die enormen Schwierigkeiten, die solche „Fünde“ zuletzt immer als innerhalb eines geschlossenen Repertoires exerzierte Inszenierungen darstehen lassen, ergeben sich auch hier.
Wie ist es um den ersten Satz aus Julliens Buch selbst bestellt, gesetzt, der Anfang fände sich vorn und zu Beginn? Er müsste, wie dargestellt, nach dessen eigener Theorie monadisch übers ganze Prozedere bereits Aufschluß gewähren. Es sind da jedoch, entscheidende Zwickmühle, deren zwei: jener eines kurzen Vorworts (des Anfangs vor dem Anfang) und der Satz, der den mit römisch I überschriebenen Abschnitt eröffnet.
Anfang 1: „Seltsam, doch alles in allem logisch, dass ich erst jetzt zu der Frage komme, mit der ich in der Werkstatt meines Schaffens hätte beginnen müssen.“
Anfang 2: „Sich einlassen heißt im buchstäblichsten Sinn zunächst einmal eintreten: von einem Draußen in ein Drinnen gelangen.
Zwei mögliche Wege des Anfangens somit oder ein in sich selbst gedoppelter, von denen der erste sich der (dann doch wieder logischen!) Seltsamkeit konfrontiert sieht, dass der Anfang (den Jullien im folgenden zumindest in Gestalt des ersten Satzes etwa von Prousts Recherche oder dessen von Aristoleles Nikomachischer Ethik tatsächlich am Anfang sucht), der legitime Anfang, der eigentlich hätte das Erste sein müssen, manchmal der abstrakten Zeitordnung nach später kommt als erwartet. Oft erst, so wie man das Vorwort eines Buches zuletzt schreibt, am Ende. Zusammen mit der ebenfalls erst verzögert auftauchenden Frage, ob es überhaupt nötig sei zu fragen oder gar nur eine westliche Spezialität („Warum das warum?“ hatte auch Heidegger sinniert), wirft dies reflexive Aporien auf, die im Rahmen des Buches nicht gelöst, sondern weiter radikalisiert und entfaltet werden. Sie sind deren Gegenstand. Ob es wirklich gelingt, dahinter zu kommen, was es heißt einzutreten (was ja auch besagte: Zugang zudem erlangen, was „Zugang“, was „eintreten“ bedeuten könnte), „eine Schwelle zu übertreten“, wie der zweite Anfang avisiert, bleibt bis zuletzt unklar. Denn muss eine Topographie, die meint, säuberlich Interieur und Exterieur, Selbes und Anderes trennen zu können, auf der Suche nach der Schwelle, gerade im Falle einer komparatistischen Untersuchung (die keine solche sein will: Julliens Begriff von Einlassen und Eintreten setzt sich explizit von jedem Vergleichen ab, ohne doch auf es verzichten zu können), die Europäisches mit Chinesischem (dieser vermeintlich inkommensurablen Exteriorität) vergleicht, nicht als unrettbar unterkomplex erscheinen? Julliens Formulierungsweise, sein Duktus, verstehen es, solchen Verstrickungen zu Wort zu verhelfen, ohne einfache Auswege anzuempfehlen. Der Anfang ist gespalten, es gibt davon mindestens zwei, in Wahrheit eine unendliche Pluralität, und er bleibt im Kommen.
***
O Asia, das Echo von dir und es bricht sich Am Kapitol und jählings herab von den Alpen. (Hölderlin, Am Quell der Donau)
Fürs europäische Denken (dem eine gewisse Konsistenz deshalb zu unterstellen ist, weil es selbst versucht, im Bezug auf sich, eine solche herzustellen, sich als Kanon zu schließen) heißt das, die ohnehin schon in sich gespaltene griechisch-römisch-jüdisch-christliche Schöpfungserzählung, die wiederum aus ägyptischem, dann wohl babylonischen Fundus sich speist, widerspricht sich in sich ebenso sehr, wie sie auf anderer Ebene Einklang suggeriert. Einerseits nämlich scheint sich nichts so sehr zu widersprechen wie die vom gebietenden Wort ausgehende ex nihilo (oder fiat-) Kreation der Genesis und die qua Zeugung verfahrene Theogonie nach Hesiodschem Muster, bei der Götter einander zeugen und dadurch ein Wuchern schaffen, dass erst durchs Gewaltmonopol eines Zeus zu gewisser Stabilität gelangt. Andererseits: finden sich nicht Elemente des einen auch immer im anderen? Überdies lehrt die Beschäftigung mit Indien: die Anfänge wuchern, je verbissener man sich eines solchen zu vergewissern bestrebt ist, desto entschiedener pluralisiert er sich. Das Innen befindet sich eingefaltet im Außen, das Außen im Innen. Was heißt dann aber, nochmals gefragt bis zur Erschöpfung, eintreten, was „sich einlassen“? Ist man irgendwie nicht schon immer Drin, sofern das Andere, sei es noch so heterogen, stets bereits eingeschlossen ist ins mit sich selbst uneinige Eine, wenn auch als Ausgeschlossenes? „Jewgreek is greekjew. Extremes meet. „
„Wir werden uns in Europa nicht mehr auf den Horizont des europäschen Denkens beschränken können. Wir müssen unser Zuhause verlassen und unseren philosophischen Atavismus abschütteln — uns anderswo „umschauen“, was bereits bei den Griechen, erinnern wir uns, die erste Bedeutung von „Theorie“ war, bevor sie platt und spekulativ wurde.“ (S.11)
Der Osten allerdings scheint dieser immer per Scheidung und Bruch verfahrenden hebräisch/hellenischen Wurzel etwas Drittes beizufügen, was von beiden Modellen nicht gedacht wurde. Ob man hierin in allen Punkten dem Autor folgen wird ist unsicher. Zu nahe liegt der Verdacht, dass auch das Ungedachte im Gedachten bereits seinen Abdruck hinterlassen haben wird.
Gerade in Hinblick auf eine so absolute Exteriorität wie China und sein Denken, das, wie Jullien expliziert, allein aufgrund seiner nicht der großen indoeuropäischen Familie angehörigen Sprache, ohne Konjugation, Deklination, Morphologie, seiner nicht phonetischen, sondern ideographischen Schrift, seines „singulären Bezug[s] zur Mündlichkeit ebenso wie eine nicht gelockerte Abhängigkeit von der gestaltgebenende Macht des Duktus“ tatsächlich den europäischen Gepflogenheiten zunächst sehr fremd und ungewohnt gegenüber steht, stellt sich leicht der Eindruck einer „schönen Fremde“ (Eichendorff) ein, die romantisch überhört und mit sämlichen Sehnsüchten aufgeladen wird, die sich in der langen Geschichte des abendländischen Denkens akkumuliert haben. Ein eurozentrischer Exotismus ist dann die Folge, der von Beginn seiner Publikationstätigkeit an Jullien zum Vorwurf gemacht wurde.
***
und die Liebsten Nah wohnen, ermattend auf Getrenntesten Bergen, So gib unschuldig Wasser, O Fittiche gib uns, treuesten Sinns Hinüberzugehn und wiederzukehren.
Tatsächlich jedoch hat dieser immer wieder im Blick behalten, dass solche Gefahr nie vermeidbar ist; so dass es darum geht, auf geschickte Art mit ihr umzugehen. Ähnlich wie dem hermeneutischen Zirkel der Ruf anhaftet, es käme nicht so sehr darauf an , ihm zu entkommen, als auf den geeigneten Modus in ihn hinein zu gelangen, so arbeitet Jullien an einer offenen Frage („Was heißt es überhaupt sich auf etwas anderes einzulassen?“) prozessual, indem er operativ, im Übersetzungsvorgang, dem wechselweisen Hinaustreten und Hereintreten, dem oszillierenden close/distant reading eine Schwelle aufspüren möchte (und Hermes, man erinnert sich, ist der Gott derselben), die Unvergleichliches verbindet und doch ihr Besonderes würdigt und vor Nivellierung bewahrt. Vor allem gilt es „mögliche Wege“ aufzuzeigen innerhalb eines nicht totalisierbaren Repertoires für „jedwede Intelligenz“; eine „Phänomenologie des Geistes“ wäre zu schreiben, die nicht mehr nur europäisch ist und es irgendwie vermag, die Problematik einer immer nur per analogiam appräsentierbaren Alterität in jede ihrer Operationen mit hinein zu nehmen. „Osterweiterung der Vernunft“ hat Peter Sloterdijk diesen Vorgang einmal genannt und man denkt an die seltsame Non-Philosophie François Laruelles (in der das „non“ keine Antithese, sondern Erweiterung wie die nicht-euklidische Geometrie sein will), mit der dieser den Versuch zu unternehmen scheint, die dezisionale, auf basalen Distinktionen beruhende Struktur aller westlichen Philosophie selbst in den Blick zu nehmen, um derart ihrer narzißtischen Suffizienz ihre Unzureichendheit vor Augen zu führen.
Dennoch: Die faszinierenden Erkundigungen dessen, was in des Autors Sicht, die den bekannten Denkwegen gegenüber radikale andere Weise des Vorgehens ausmachen soll, lässt die unheimliche, klandestine Komplizität, durch welche der Westen mit seinem verdängten, vergessenen, nie zu Kenntnis genommen Anderen immer schon verschworen ist, dies Fremde in sich bereits enthält, umso deutlicher zu Tage treten. Vielleicht besteht der Ertrag der Auseinandersetzung auch darin, einer kontraintuitiven Merkwürdigkeit gewahr zu werden: Der Westen ist bereits und anfänglich (auf eine je neu zu entwickelnde Art) chinesisch, weil sein „Innen“ in seiner Immanenz nicht klar umschrieben ist. In sich selbst Alterität, die, um ihrer gewahr zu werden, der Konfrontation mit einer externalisierten Inkommensurabilität zu bedürfen scheint …
Tillmann Reik