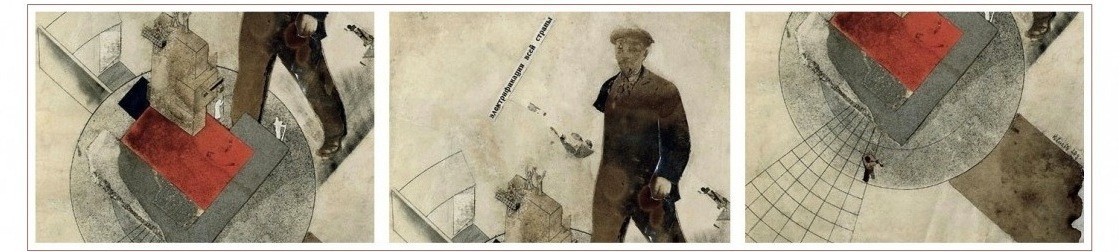Auf Horchposten. Zenders sonorer Zen-Sinn
Auf Horchposten. Zenders sonorer Zen-Sinn
Die Form des erwachenden Geistes ist die Verehrung.
Ludwig Wittgenstein
Ihre Begleitung ist leise. Das gebe ich zu. Aber man hört nicht, dass sie auf ihn hören. Und das kann ich, wenn ich sonst nichts kann, ich kann das immer hören, ob jemand auf jemand anderen hört. Das hat einen ganz besonderen wartenden, tastenden Klang, wenn Menschen auf einen anderen hören.
Carlos Kleiber
Der Name des 1936 geborenen Dirigenten und Komponisten „neuer Musik“ Hans Zender bereits enthält einen Hinweis auf die Empfänglichkeit seines denkerischen und kompositorischen Schaffens für die vom Daoismus beeinflußte Meditationstechnik des Mahayana-Buddhismus, der Einübung — Buddha ist der Erwachte — ins Erwachen: Zen öffnet hier („die Zeit, der Raum, das Hier, das Jetzt, ist das Herzstück jeder Kunst“) den abendländischen RaumBlick (als ebensolchen optozentrisches Denken unterm Visualprimat sich bevorzugt selbstbeschreibt) hin zum Hören der Zeit; das Denken versucht sich einem Nichtdenken in ihm selbst zu nähern, einer, sinnlichen, leiblichen Achtsamkeit, die der Autor auch als Konzentration und Sammlung, Fähigkeit, die Stille zu hören, fasst und vorsichtig in die arkane Zone einer nicht falsch (nämlich körperlos) zu verstehenden Spiritualität rückt.
Waches Hören. Über Musik, in der Edition Akzente des Hanserverlags erschienen, kompiliert 14 Aufsätze zur „alten“ und „neuen Musik“, dass „die Funken nur so sprühen“. Texte, die allesamt mehr oder weniger explizit jener „Sammlung“ gewidmet sind; auch und gerade dort, wo hauptsächlich Fragen einer Kulturpolitik verhandelt werden, die immer wieder geneigt ist, dieser vulnerablen Zone Protektion und Subvention zu verweigern. Zugunsten der usurpatorischen Monokultur event-kulturellen Entertainments. („Kulturpolitik“ und „Die große Verantwortung. Wozu brachen wir Rundfunkorchester?“)
Les sens pensent – Der Ursprung der Musik aus dem Geiste des Begeisterungsgeheuls
„I have often thought that if it is literally true that In The Beginning Was The Word, then it must have been a sung word. The Bible tells us the whole Creation story not only verbally, but in terms of verbal creation. God said: Let there be light. God said: Let there be a firmament. He created verbally. Now can you imagine God saying, just like that, ‚Let there be light,‘ as if ordering lunch? Or even in the original language: Y’hi Or? I’ve always had a private fantasy of God singing those two blazing words: Y’HI OOOR! Now that could really have done it; music could have caused light to break forth.“(Leonard Bernstein)
Denken der Sinne, der Titel einer weiteren Schriftensammlung („Die Sinne denken“) prägt es, oszilliert dann nicht nur zwischen beiden Genitivbedeutungen, sondern lässt auch unentschieden, ob hier die Selbstverständlichkeit eines Pleonasmus oder eher eine allem Gemeinsinn zuwiderlaufende oxymoronische Paradoxie vorliegt. Können Sinne denken? Kann man sie denken? Zenders sonore réponse (ein Titel im Band: „Canto ergo sum“), die ihm gemäße kantable („In einem bestimmten Sinne könnte man alle meine Stücke als „Canti“ bezeichnen“) Entschlüsselungsweise der Gnome lässt sich, klanglich ausgehört, einem am Ende des Bandes abgedruckten Brief an Albrecht Wellmer entnehmen:
„Ce sont les sens qui pensent“.
Überwunden erscheint damit der Gegensatz von Wahrnehmung und Verstandesvermögen, wie der von sinnlichem und sinnhaftem Sinn, sense und sensibility. Die Sinne sind es (wohlverstanden nicht in ihrer Zahl reduzierbar), die denken, d.h. der Körper als Partitur erogener Zonen, wodurch sich eine Deutung des logos als ein Spüren oder Gespür eröffnet, das aller sprachlichen Sinnhaftigkeit vorausliegt oder sie übersteigt, sie überhaupt erst ermöglicht. Hier lässt sich auch an ein Vernehmen denken, von dem Vernunft ihren Namen bezieht, das in ihr mitklingt.
„Ein Spüren von Sinn, dem die Worte noch fehlen – der aber von Worten auch nicht begrenzt oder in die Irre geführt werden kann.
Musikologische Erwägungen gingen, folgt man den instruktiven Abhandungen, hört man sich in sie ein, ohne ein Gespür für jenen „musikeigenen Logos“ (oder die logoseigene Sonorität?) fehl. Zender neigt dazu, Musik mit Cage sehr weit zu fassen und mit Messiaen vom Vogelgesang herzuleiten oder, darüber hinaus, vom Ur-Geheul der ekstatischen Begeisterung:
In mir hatte sich von Kindesbeinen an eine andere Vorstellung vom Ursprung der Musik wie der Sprache gebildet: die Vorstellung eines ekstatischen Geheuls irgend eines Urmenschen, ausgestoßen aus übergroßer Begeisterung, zu Ehren eines besonderen Ortes, eines Fetischs, eines heiligen Baumes.
So dass im Resultat die abendländische Kunstmusik nur noch als ein Ableger einer die Sprache und den Menschen überschreitenden und begründenden, gestischen, ex- und akklamatorischen Ausdrucksform erscheint. Letztlich laufen die Einübungen, für die das Buch wirbt, neben einem „Verstehen des Verstehens“, auf ein Hören aufs Hören (des Hörens des Hörens des…), ein Spüren des Spürens (des Spürens des Spürens des …) hinaus, dessen Struktur Selbstaffektion ist, die Bedingung jeder Öffnung fürs Andere.
„Wir müssen das Hören verstehen, um besser zu verstehen, was Musik ist.“
Will man solche Untersuchungen nun Hörphysiologie nennen oder mit dem Oxymoron einer „Phänomenologie des Hörens“ versehen? Oxymoron deshalb, weil das, was sich im akustischen Bereich an gegebenen Sinnesdaten zuspielt, mit greifbaren Phänomenen (die eine semantische Referenz auf die Sichtbarkeit dessen, was am hellichten Tage sich zeigt, nahelegen) nicht mehr zu tun hat. Adorno etwa schreibt, Musik könne „nur durch sinnlich nicht Präsentes, durch Erinnerung oder Erwartung verstanden werden“. Andererseits rekuriert gerade die „Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins“ Husserls in ihrer Darlegung der Intentionalität auf das Hören einer Melodie. Phänomene jedoch bleiben, gerade im akustischen Bereich, Phantome, deren Präsenz sich durchweg entzieht. Schon nicht mehr/noch nicht aber irgendwie doch schon.
Quid enim est tempus?
PARSIFAL Ich schreite kaum, – doch wähn‘ ich mich schon weit. GURNEMANZ Du siehst, mein Sohn, zum Raum wird hier die Zeit.
Nichtsdestotrotz bedient sich Zender in seiner Explikation des musikalischen Verstehensvorgangs einer an Husserl erinnernden Beschreibungsweise, weicht an entscheidenden Punkten allerdings von ihr ab. Sein, oft ein Koan zu Hilfe nehmender Begriff von Gegenwart überbietet den phänomenologischen, reichert ihn an und entleert ihn zugleich zum zenbudhistischen Nicht-Ort des nicht-intentionalen Hörens à la Cage. Ununwunden und hellsichtiger als bei neo-mystischen Lehren von der „Power of Now“ (Eckhart Tolle) wird diese Stabilisierung einer Dauer im Kampf gegen die Flüchtigkeit als „Gewaltakt“ bezeichnet. Doch geht es nicht eher um das Spürbarweden jener Dimension, in der sich Klang überhaupt zuträgt, in der er Statt hat: Raumzeit oder Zeitraum? Spätestens seit Brucker („Zur Konstruktion der Zeit bei Anton Bruckner“), dessen Erweiterung der Zeitwahrnehmung ihn zum immer noch (etwa von Adorno) verkannten Avangardisten promoviert, ist derartiges, Zeit-Raum, hör- und erfahrbar.
Wenn von Sammlung und Konzentration die Rede ist (und gerade letzterer Begriff trägt eher unheilvolle Konnotationen mit sich; Zender allerdings möchte in ihm den „Zeitkreis“ hören), zeigt sich schnell, dass die Überlegung dem denkenden Sensorium eine andere Aufgabe zuspricht als bloß, divergente Mannigfaltigkeiten herrisch zu vereinheitlichen und so einer stabilisierten Ganzheit zuzuführen. Der Aufsatz über Zenders „Logos-Fragmente“ stellt heraus, was auch „Von Hölderlin ausgehend“ deutlich werden läst: Das Ganze ist nicht das Eine; Kohärenz, Zusammendenken und -hören, verlangt, Splitter, Fragmente, Stücke („Die Sprache selbst hat ja unsere kompositorischen Produkte seit jeher Stücke nennen lassen – allerdings immer verbunden mit der Vorstellung eines im systematischen Sinn geschlossenen Zusammenhangs.“) derart zu „sammeln“, in Formation zu bringen, dass deren – auch stilistische – Disparität erhalten bleibt. Gespannteste, wache Aufmerksamkeit – obiger Gewaltakt – erfordert deshalb gleichzeitig das lässige, gelassene Lockerlassenkönnen von Zersteuung; Ent-/Anspannung.
Das Denken in Fragmenten ist also eine Weise, eine Ganzheit zu umgreifen, die nicht als eine erkannbare „logische“ Einheit vorgestellt wird, sondern als ein sich in ständigem Entstehen begriffenes Gefüge von Kräften.
Dispensiert wird das „Eine“ nicht. Sein Begriff jedoch kann nicht länger als versichernde Rundung erscheinen, sondern fällt zusammen mit einer unabschließbaren Öffnung fürs Verschiedene:
Trotzdem bleibt die Sehnsucht nach dem „Einen“ – ja man könnte sagen, dass die entstandene unübersehbare Vielheit nur dessen Rückseite ist. Aber diese Einheit kann nicht mehr – im Kontext der Morderne und schon im Werk Hölderlins – als harmonische, alle Gegensätze vermittelnde Gestalt dargestellt weden; sie erscheint als absolute Offenheit, Unbestimmtheit und Leere, und solche als der Grund jener „äußersten“ und beängstigenden Freiheit, in die uns die Moderne versetzt hat.
Der „ganz besondere, wartende, tastende Klang“ des Hörens aufs Hören und der Musik als Sphäre dieser traumwandlerischen Vigilanz, Attentionalität: in Zenders so wissenschaftlichen wie poetischen Auskultationen ist er überall zu vernehmen.
Tillmann Reik
Hans Zender: „Waches Hören“. Über Musik. Hrsg. von Jörn Peter Hiekel. Carl Hanser Verlag, München 2014. 184 S., geb., 19,90 Euro.