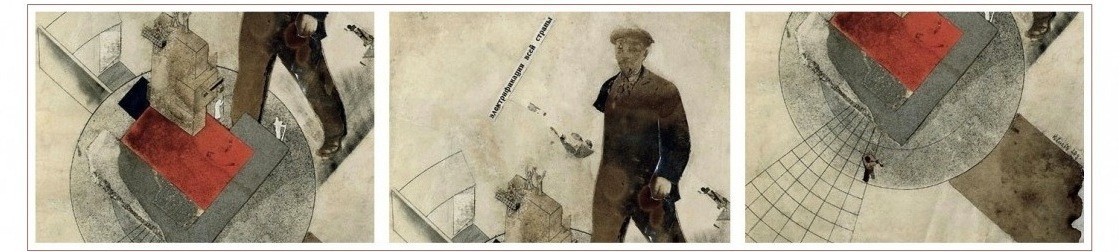Fichue-Fichen
Fichue-Fichen
„Die über die Haare gelegte und durch einen Kamm befestigte Spitze umrahmte das Gesicht und verhüllte die Brüste ganz, war aber so schmiegsam und durchsichtig, dass man den Warzenhof ahnte und begriff, dass sie unter dem Fichu frei waren.“ (Pauline Réage: Rückehr nach Roissy)
Titel, zugleich innen und außen, steckt einen Rahmen ab und eröffnet einen Spielraum.
Fichue:
„Was ist das für ein Titel? Was denkt man dabei? – Nicht mehr und nicht weniger, als man bei einem Titel denken soll. Ein Titel muß kein Küchenzettel sein. Je weniger er von dem Inhalt verrät, desto besser ist er.“
So Lessing, dessen Titel-These Adorno, der bald schon auf die heutzutage offenbar werdende, hoffnungslose „Unmöglichkeit der Titel“ zu sprechen kommt, in einem Aufsatz seines (dank Peter Suhrkamp) „Noten zur Literatur“ betitelten Buchs mit dem bezeichnenden Titel „Titel“, zitiert. Hoffnungslos – platonische Anamnesislehre hin oder her – sich voluntativ auf das Eigentliche, Vergessene, Verborgene besinnen, es hervorzerren zu wollen. Gut wäre indessen ein Titel, durch den, absichtlos und didaktikfern, ein Werk sich selbst nennt, adamitisch mit seinem Namen zusammenfällt. Er findet sich eher, fällt zu, nach dem Beispiel einer memoire involontaire, als dass er einfach suchbar ist. Durchsichtig wird die Undurchsichtigkeit jedes fruchtbaren Gedankens für sich selbst:
„Nach Titeln suchen ist so hoffnungslos, wie wenn man sich auf ein vergessenes Wort besinnt, von dem man zu wissen glaubt, alles hänge daran, daß man seiner sich erinnere. Denn jedes Werk, wenn nicht jeder fruchtbare Gedanke, ist sich verborgen; nie sich selbst durchsichtig. Der gesuchte Titel aber will immer das Verborgene hervorzerren. Das verweigert das Werk zu seinem Schutz. Die guten Titel sind so nahe an der Sache, daß sie deren Verborgenheit achten; daran freveln die intentionierten.“
Von „Werk“, in einer Adorno womöglich zeitlebens vorschwebenden emphatischen Bedeutung eines integralen Gebildes (selbst wenn es nichts als seine Zersetzung konsequent austrägt), kann nun bei einem Magazin, einer Zeitschrift, kurz einer losen und lockeren Kol-Lektion von Notaten weniger denn je die Rede sein. Eine Sammlung von prosaisch, poetisch, theoretischen Zettelträumen, Karteikarten, Akten (frz. fiche). Post-it-Haftnotizen, mal mehr mal weniger ausgearbeitet. Mehr soll hier nicht geboten sein, aber auch nicht weniger.
Dadurch bot sich, nebensächlich, ein Name an, der, bescheidener und unverblümter, auf Accessoire, Zierat, Dekor, Beiwerk, Ornament abstellt, das jedoch den ganz vordergründigen Hintersinn des anstandwahrenden und gleichzeitig womöglich erotisch verführerischen Verschleierns mitführt: die Sprache der Mode, ein Kleidungsstück, ein Schal, ein Tuch:
„Erlauben Sie mir, zunächst einen Satz zu lesen, den Walter Benjamin eines Tages, eines Nachts auf Französisch träumte […]. Er hat ihn Gretel Adorno auf Französisch in einem Brief anvertraut, den er ihr am 12. Oktober 1939 aus der Nièvreschrieb, wo er interniert war. Camps de travailleurs volontaires, „Freiwilligen-Arbeitslager“, hieß dergleichen damals in Frankreich. In seinem Traum, der, wenn man ihm glauben darf, euphorisch war, sagt Benjamin sich also auf Französisch: Il s’agissait de changer en fichu une poésie. Und er übersetzt: „Es handelte sich darum, aus einem Gedicht ein Halstuch zu machen.“ Wir werden später diesem fichu nachsinnen, dieses Halstuch oder diesen Schal durch die Finger gleiten lassen und uns jenen Buchstaben des Alphabets vor Augen führen, den Benjamin im Traum auf ihm zu erkennen glaubte. Und fichu, auch das wird uns beschäftigen, ist nicht bloß irgendein französisches Wort für den Schal oder das Halstuch einer Frau.“
Nicht bloß, wie die hier gesammelten Texte also, ein die Blöße bedeckendes und damit ausstellendes Tuch, Textil (tissu und toile) und Gewebe mithin, das flirrend Geschlechterdifferenz markiert und überschreitet. Adjektivisch und adverbial auch das Bloßliegen, Kaputt- und Abgehalftertsein. Fix (wie fichu von lat. figere, anheften, hergeleitet) und fertig:
„Le fichu“, und das ist die augenfälligste Bedeutung des Wortes in dem Satz Benjamins, bezeichnet also einen Schal, jenes Stück Tuch, das eine Frau sich schnell noch um ihren Kopf oder Hals schlingen mag. Das Adjektiv fichu dagegen meint das Schlechte: das, was übel, verdorben, verloren, verdammt ist. An einem Tag des Jahres 1970, als er seinen Tod kommen sah, vertraute mir mein Vater an: „Je suis fichu“ – „ich bin fertig“, „mit mir ist es aus“.
Warum nun der Abschied von genererischer Maskulinität, die doch stellvertretend und repräsentativ fürs ihr Andere einen neutralen Anstrich hat? Warum fichue mit unhörbarer femininer Extension, weiblichem Addendum?
(Tja, warum? Ehrlich gesagt, vielleicht einfach, weil alles andere bereits okkupiert war? Weil nur das feminine Genus einen Freiraum bot?)
„Und schließlich: alles Schreiben ist triumphierend. Schreiben ist Triumph (Schreiben und Siegenwollen*), manische Versicherung des Über-Lebens (sur-vie). Das macht es unerträglich. Von Grund auf schamlosund exhibitionistisch. Selbst wenn man darin kein „das hier bin ich“ liest. Und die gesteigerte Diskretion ist nur Mehrwert des Triumphs, Ergänzung des Triumphs – zum Kotzen.“ (Derrida, Gestade, S.169)
Es sei, also, in allen Bedeutungen von ficher, die das erfassende Fixieren heraus hören lassen, nicht nur das Fix-und-Fertige, das Kaputte mitgemeint, sondern jenes bedacht, was im Französischen friche heisst: die Brache.