Köpfe/Rollen
„Der neue Chef ist ein Problem, das sich mit strukturbedingter Typizität laufend wiederholt, eines der wenigen Organisationsprobleme, dem mit Recht universelle Bedeutung beigemessen werden kann.“ (Niklas Luhmann, S.10)
„As for my title, I suppose that the word Cape is from the French cap; which is from the Latin caput, a head; which is, perhaps, from the verb capere, to take, — that being the part by which we take hold of a thing.“ (Henry David Thoreau, Walden)
Das aus dem Französischen entlehnte Substantiv “Chef” schreibt sich, ebenso wie Kapital, Kapitän, Kapitel, der zwei- und dreiköpfige Bi- und Trizeps, aber auch das erfolgreiche Erreichen eines Ziels, die Vollendung innerhalb einer Teleologie, achievement (ad caput venire), vom lateinischen caput her. Es deutet damit, anfangs nur im militärischen Kontext, dem straff durchorganisierten Heer, wo es den kommandoführenden General bezeichnet, hinauf auf den Kopf und das Oberhaupt; die höchste und wichtigste, durch die exponierte Lage jedoch ebenso höchst verletzliche zephalische Stelle innerhalb einer den machtpolitischen Stellenwert ihrer Teile und die Richtung der Befehlskette ordnenden Hierarchie. Zunächst besteht die Hauptsache der Hauptsache als zentraler kybernetischer Steuerungseinheit darin, zahlenmäßig beschränkt, wenn nicht Unikat zu sein, ihre Exzellenz verdankt sich ihrer raren Exklusivität. Doch es dauert nicht lange, bis diese am Aufbau des biologischen Organismus orientierte Metaphorik, spätestens nachdem der Kopf des absolutistischen Herrschers, der im Übrigen schon lange verdoppelt und multipliziert – nämlich in Person einerseits und Erwartungen stabilisierende Rollen andererseits aufgesplittert – war, gefallen und ebenso schnell durch vielfältig nachwachsende Supplemente ersetzt wurde, auch in anderen sozialen Verhältnissen Verwendung fand, zu proliferieren begann und eine Diversität von Häuptlingen einer aus dieser Sicht als poly-tribaler Stammesverbund erscheinende Gesellschaft generierte, wie sie sich etwa in der folgenden bürokratischen, der Ordnung halber alphabetisch sortierten Beispiel-Liste eines gängigen Online-Wörterbuchs niederschlägt, die unendlich ergänzbar ist:
Abteilungschef, Aufsichtsratschef, Betriebsratchef, Ex-Chef, Fraktionschef, Gruppenchef, Konzernbetriebsratchef, Konzernchef, Kreml-Chef, Küchenchef, Länderchef, Landeschef, Marketingchef, Nationalbankchef, Notenbankchef, Parteichef, Polizeichef, Regierungschef, Ressortchef, Terrorgruppenchef, Staatschef, Stabschef, Strategiechef, Verwaltungschef, Vorstandschef, Zentralbankchef
nach Firma/Organisation: Al-Kaida-Chef, Belvedere-Chef, BMW-Chef, Chrysler-Chef, CIA-Chef, Daimler-Chef, Euro-Gruppe-Chef, Ex-Grünen-Chef, Ex-Linken-Chef, EZB-Chef, Flughafenchef, Formel-1-Chef, FPÖ-Chef, Grünen-Chef, IPCC-Chef, IS-Chef, Mercedes-Chef, ÖBB-Aufsichtsratschef, ÖGB-Chef, ÖVP-Chef, PKK-Chef, SPD-Chef, SPÖ-Chef, Volkswagen-Chef (VW-Chef)
Chefdirigent, Chefetage, Chefinstruktor, Chefkoch, Chefkombination, Chefredakteur, Chefsache, Chefsalat, Chefsessel
***
Köpfe, die ins Rollen geraten und andererseits (weil sich die Soziologie früh, einschlägig bei Goffman, der Theaterterminologie bedient, um deutlich zu machen, wie sich Soziales inszeniert) Rollen markieren, die selbst stabil bleiben müssen, während die sie spielenden Akteure wechseln. Ist in tribalen Formationen die Rollenzuteilung weitgehend festgeschrieben und geregelt, erweist sie sich in funktional differenzierten Verhältnissen als variabel:
Stabilität ist im sozialen Leben nur erreichbar, wenn das Verhalten der anderen Menschen voraussehbar ist, wenn also zuverlässige wechselseitige Verhaltenserwartungen durchweg erfüllt werden. Dazu gehört, daß diese Verhaltenserwartungen in verschiedener Hinsicht generalisiert sind: daß sie zu komplexen Typen mit verschiedenen Ausführungsmöglichkeiten zusammengefaß sind, daß sie wiederholbar sind, daß sie Konsens finden und daß sie normativen Sinn erhalten und dadurch fortbestehen, auch wenn sie im Einzelfall faktisch enttäuscht werden. Generalisierte Verhaltenserwartungen solcher Art werden heute allgemein als Rollen bezeichnet. (11)
Das Familienoberhaupt ist zugleich Produktionsleiter, Kriegschef, Vortänzer, Mitglied des Stammesrates und anderes mehr. Sein Nachfolger rückt in alle diese Rollen ein. (12)
Ein Konzernpräsident kann verheiratet oder unverheiratet, Tänzer oder Nichttänzer, Kirchenmitglied, Jäger usw. sein. Für das Zusammentreffen solcher Rollen in einer Person gibt es kaum noch soziale Regeln und für Rollenkonflikte keine sozial akzeptierten Lösungen mehr. Jede Nachfolge in eine Rolle bringt daher neue Kombinationen und neue Probleme mit sich. (13)
Immer geht es, wenn – austauschbare – Vorgesetzte im Spiel sind, um Organisation, die sich hierarchisch strukturiert, mit Über- und Unterordnung einer Rangfolge von Mitgliedern über Rollen Kohärenz und Erwartungssicherheit stabilisiert und dadurch Reste segmentärer und stratifikatorischer Gesellschaftsformationen in die moderne, basal funktional differenzierte (und damit laut der gängigen Terminologie: heterarchische, hyperkomplexe und polykontexturale) überführt. Dort wirken derlei per Ein- und Auschluß Mitglieder rekrutierende und “Leute funktional substituierende” Entitäten wie archaische, anachronistische, atavistische Relikte aus grauer Vorzeit, garantieren andererseits jedoch überhaupt erst die strukturelle Kopplung grundsätzlich inkompatibler Funktionssysteme, sind selbst so etwas wie aus den Funktionssystemen herausragende Köpfe. Die Zeit der Moderne (und Postmoderne) ist insofern aus den Fugen und mit sich selbst uneins, als das Entscheidende (und Organisiationen mit ihren legitimierten und legitimierenden formalen Verfahren sind insofern wichtig, als sie Entscheidungen mit Bindungskraft kommunizieren können, um damit die besagte re-ligio/Wiederanbindung des Disparaten zu leisten) an modernen Gesellschaften eben auch etwas ist, was ihre wertvollsten Errungenschaften (die funktionale Differenzierung selbst) stets radikal in Frage stellt:
Der Luhmannschüler Peter Fuchs schreibt dazu in seinem Manuskript “Hierarchien unter Druck – ein Blick auf ihre Funktion und ihren Wandel”(abrufbar unter http://fen.ch/texte/gast_fuchs_hierarchie.pdf):
Organisationen sind in der Lage, die ‚Leute’ funktional zu substituieren. Genau deswegen sind sie diejenigen Einrichtungen, die die strukturelle Kopplung der Funktionssysteme durchführen und damit jene Kompossibilität ins Werk setzen, ohne die funktionale Differenzierung nicht existieren könnte.
Und Fuchs zitiert den späten Luhmann, dessen Ausführungen darin kulminieren, die Ambiguität von Einrichtungen zu betonen, deren Unverzichtbarkeit mit einer Infragestellung gerade jener Errungenschaften einhergeht, die sie andererseits garantieren:
„Sie (die Organisationen, P.F.) können die Personen auswählen, die für eine Tätigkeit in ihren Organisationen in Betracht kommen, und andere ausschließen. Nicht alle Bürger werden Beamte. Funktionssysteme können also mit Hilfe ihrer Organisationen dem Inklusionsdruck der Gesellschaft widerstehen. Jeder ist rechtsfähig, aber nicht jeder bekommt vor Gericht Recht. Das Gleichheitsgebot ist kein Konditionalprogramm. Jeder hat die Schule zu besuchen; aber da es sich um eine Organisation handelt, kann intern entschieden werden, auf welchem Niveau und mit welchem Erfolg. Über Organisationen macht die Gesellschaft sich diskriminationsfähig, und zwar typisch in einer Weise, die auf Funktion, Code und Programme der Funktionssysteme abgestimmt ist. Innerhalb der Organisationen und mit ihrer Hilfe läßt die Gesellschaft die Grundsätze der Freiheit und der Gleichheit scheitern.”
***
All diesen und weiteren Verstrickungen, welche die späten organisationssoziologischen Überlegungen Luhmanns, gesammelt im postumen Werk Organisation und Entscheidung (2000), zu Bedenken geben (und die u.a. durch einen starken Exklusionsbegriff frühere Theorieprämissen der systemischen All-Inklusion destabilisieren), sind in den drei frühen Aufsätzen, die das gelbe Suhrkampbüchlein Der neue Chef enthält nur zu erahnen; dafür zeigt sich sich eine (tranzendental-)empirisch gesättigte Binnenperspektive vor allem der bürokratischen Verwaltung der biedermeierlichen Bonner Bundesrepublik weniger als 20 Jahre nach Kriegsende. Bürokratie, die heilige Herrschaft des Beamtenapparats in seinen Schreibstuben und Amtszimmern bildet das kafkaeske – allerdings auf die modernen industriegesellschaftlichen Bürokratien bezogene Szenario dieser Überlegungen. Weder Vademecum noch Handorakel für die Bewältigung des Alltags in hierarchisch organisierten Arbeitsverhältnissen – wenngleich das von Jürgen Kaube erstmals publizierte und wohl nicht ohne Grund vom Autor zurückgehaltene Typoskript “Unterwachung oder Die Kunst, Vorgesetzte zu lenken” als Leitfaden der subtilen Subversion von scheinbar eindeutigen Machtverhältnissen dienen kann – bieten die im 111 Seiten umfassenden Band “Der neue Chef” versammelten drei Texte einen Einblick in Luhmanns organisationssoziologische Frühphase, der entscheidende Schnitte und terminologische Feinunterteilungen, mit denen Luhmann später die Gesellschaft zerlegen wird, um sie danach wieder zusammenzusetzen, noch nicht vorgenommen sind.
Allesamt im Umkreis der Schrift Funktion und Formen formaler Organisation (1964) mit der Luhmann 1966 auch promoviert wurde, entstanden und von Erfahrungen der Jahre 1954-62 als Ministerialbeamter in Lüneburg gespeist, gewähren sie dennoch aufschlußreiche Vorführungen der seltsamen, mitunter grotesk anmutenden Beobachtungsgabe des späteren Bielefelder Soziologieprofessors, dem guter Geist trocken war und der Gag die Mittel heiligt: einer Mischung aus naivster, ja blauäugig-ahnungsloser Überraschungsbereitschaft (wie sie der Band “Gibt es eigentlich den Berliner Zoo noch?” vielfältig illustriert), die ein bescheidenes, tastendes, phänomenologisch-deskriptives Vorgehen mit sich bringt und gleichzeitigem beherzten, risikoaffinen Drauflostheoretisieren, nicht selten allerdings über geschlossener Wolkendecke mit dem eingeschaltetem Autopilot formalisierender Hochabstraktion. Schlagend belegt dies methodisch paradoxe und so sympathische wie problematische Doppel von Zurückhaltung und Überstürztheit jene von Andrea Frank überlieferte Anekdote über einen Luhmann in orangfarbenem Volvo, der, zunächst perplex angesichts der Aporie, eine Kreuzung mit ausgefallener Ampelanlage, offenbar im blinden Vertrauen darauf, dass es schon gutgehen werde, überquert:
„Was ist denn hier los, was soll ich denn hier machen …?“, um sogleich entschlossen hinzuzufügen, „Ach, ich fahre einfach!“ Sprachs, nahm den Fuß von der Bremse und überquerte ohne weiteren Blick nach rechts oder links die kreuzende Vorfahrtsstraße (glücklicherweise ohne damit sich oder sonst jemanden zu gefährden). In diesem Augenblick wurde ihr klar, warum Luhmann in seinen Vorträgen so häufig Beispiele aus dem Bereich des Straßenverkehrs wählte: Er wunderte sich einfach darüber, wie das alles funktioniert und die Beteiligten in den meisten Fällen schadlos hält.“ (vgl. Andrea Frank: Weder Naserümpfen noch Augenaufschlag, in: Theodor Bardmann, Dirk Baecker (Hg.): „Gibt es eigentlich den Berliner Zoo noch?“ Erinnerungen an Niklas Luhmann, Konstanz 1999, S. 69.)
Der neue Chef, titelgebender erster Aufsatz (der dem Namen nach an Kafkas Der neue Advokat und Derridas Das andere Cap erinnert, mit denen er durchaus zu tun hat) und der zweite namens Spontane Ordnungsbildung untersuchen ausgehend von der alles leitenden Annahme, Stabilität setze Erwartungssicherheit voraus, jene nach Luhmanns Ansicht von der bisherigen Verwaltungswissenschaft vernachlässigten Probleme, die sich aus einer Neubesetzung der Führungsrolle ergeben können, da zwar formale Funktionen weitgehend bruchlos an nachfolgende Amtsträger übergeben werden, die nebenherlaufenden informalen („mit all ihren gefühlsmäßigen Bindungen, mit ihren Hilfeleistungen, Gunsterweisen, Informationen, Tauschansprüchen, persönlichen Verpflichtungen und emotionalen Sicherheiten“, 38) hingegen nicht ebenso. Welche Folgeprobleme sind zu erwarten, wenn die Erwartungssicherheit durch Wegfall vertrauter Strukturen plötzlich gefährdet ist, und wie lassen sich derartige unliebsame und an Konfliktpotential reiche Situationen bereits im Vorfeld abwenden oder zumindest mildern und in ihrer Schockhaftigkeit durch antezipierende Vorwegnahme absorbieren?
Denn daran ist innerhalb dieser Axiomatik alles gelegen: Komplexität muss reduziert, Unsicherheit stabilisiert werden, Erwartungen (auch die das Einzelnen von sich selbst) bestätigt, nicht enttäuscht werden. Wie schwierig und unwahrscheinlich dieses Normale reibungslos geregelter Abläufe überhaupt umzusetzen ist, macht Luhmann ebenso deutlich, wie er auf der Notwendigkeit von Stabilisierung als Hauptfunktion von Gesellschaft besteht. Obwohl zuweilen der neutrale, rein konstative Duktus seine Unbrauchbarkeit für Wegweisungen zu behaupten müssen meint („Diese Überlegungen lassen offensichtlich keine allgemeinen Empfehlungen zu“, 32), erweist sich für Luhmann der parallel mitlaufende informale Bereich, in welchem auch ein neugedeuteter Begriff von Spontaneität zum Zuge kommt, in der seinerzeit bisherigen an dem Theorem formaler Zweckorganisation orientierten (vor allem amerikanischer) Forschung als weitgehend unterschätzt:
Die Probleme der Chefüberlastung, die Unvermeidlichkeit widerspruchsvoller Leistungsstandards, die Mängel der am Zweck-Mittel-Schema und am Befehlsmodell der Autorität orientierten klassischen Organisationslehre, die Vorteile eines persönlichlich ausgerichteten „natürlichen“ Handlungssystems, in dem Takt, Vertrauten, Tausch von Gunsterweisen, Prestigeunterschiede und die feinereren Formen gesellschaftlicher Sanktionen das Verhalten steuern — diese und andere einsichten der jüngsten Forschung dürften das Interessen an einer stärker generalisierten Systemsteuerung wecken. (39-49)
Takt wird insgeheim taktisch — obwohl sich die Ausführungen eine Reserve gegenüber Rezepten aus dem Ratgebergewerbe (und der tragischen Frage „Was tun?“) aufzuerlegen versuchen, der sie jedoch nicht standhalten mögen — als eine Art Proto-Ethik (einer Ethik, deren Hauptfunktion für den späteren Luhmann war, vor Moral zu warnen) nicht nur funktional sinnvoll bewertet und, wie alles, auf den zu erzielenden Gewinn, die zu erwartende Effizienz hin untersucht, sondern nachgerade zur conditio sine qua non störungsfreier Abläufe nobilitiert. So heißt es gegen Ende von Unterwachung Oder die Kunst, Vorgesetzte zu lenken, das mit subversiven Ratschlägen aufwartet, wie dem, den Chef durch komplizierte Formulierungen, die längere Zeit des Verstehens erfordern, die Widerspruchsmöglichkeit zu nehmen:
Wichtig ist natürlich Respekt als formale Anerkennung der ranghöheren Rolle. Hier wird oft das Problem der Servilität befürchtet. Es gibt aber Möglichkeiten, Mißachtung respektvoll zum Ausdruck zu bringen, etwa indem man sich als nicht verstehenden, gelangweilten Zuhörer zeigt. Oberste Bedingung ist Takt: Man muß den anderen als den behandeln, der er sein möchte, sozusagen die beabsichtigte Selbstdarstellung im eigenen Handeln auffangen und reflektieren. Ich habe immer wieder versucht, an den Grenzen der Taktlosigkeit zu experimentieren, es zahlt sich nicht aus. Man kann irritieren, die Situation in ein leichtes Vibrieren bringen, vielleicht so stark stören, daß Aufmerksamkeit von einem unangenehmen Thema wegkommt. Vielmehr ist damit nicht zu erreichen.
Dass Takt, Vertrauen, ebenso wie Selbstdisziplin hier taktil-strategisch, d.h. funktionalistisch als effektive Mechanismen der Komplexitätsreduktion, nicht moralische Verhaltensvorgaben behandelt und empfohlen werden und sich von der Einsicht herleiten, dass „Macht […] effektiv nur in Form von Kooporation, nicht in der Form von Konflikt“ ausgeübt werden kann, weist voraus auf die erstmal 1968 erschiene Studie Vertrauen: Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität.
Die Notwendigkeit hingegen, sich (fast ein wenig im Sinne des anerkennungstheoretisch gedeuteten frühen Hegel) im anderen als der bestätigt zu sehen, der man sein möchte (mithin etwa auch die systemtheoretische Aktualisierung der Erwartung eines augustinischen volo ut sis), hält sich durch bis zur, gegenüber den Texten im Band, fast 20 Jahre später veröffentlichten Liebe als Passion. Dort nämlich heißt es:
„Was man als Liebe sucht, was man in Intimbeziehungen sucht, wird somit in erster Linie dies sein: Validierung der Selbstdarstellung. Es geht nicht so sehr darum, daß der Liebende den Geliebten überschätzt oder gar idealisiert. Das kann diesem als ständige Aufforderung, besser zu sein, und als ständiges Diskrepanzerleben eher unangenehm sein, jedenfalls auf Dauer.“
Wie deutlich diese das spätere Werk prägenden Grundprämissen bereits im frühen verwaltungssoziologischen angelegt sind (in deren unmittelbaren Umkreis übrigens auch das vielgelesene Lob der Routine (in 55 Verwaltungsarchiv (1964)) verortet werden muss), lässt sich nun weitergehend erforschen.
Tillmann Reik
Informationen zum Buch
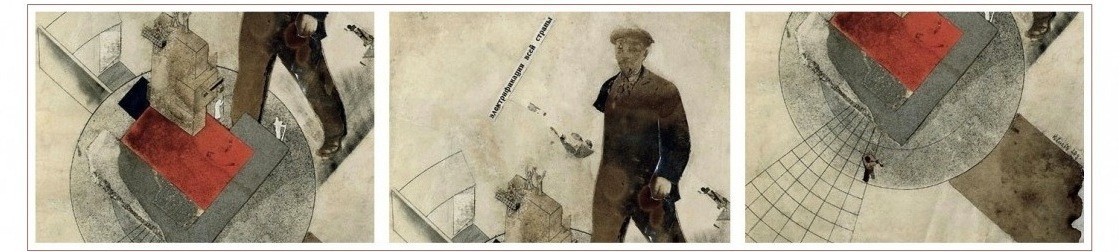



![3ac203ec96[1]](https://fichue.files.wordpress.com/2016/08/3ac203ec961.jpg?w=191&h=300)