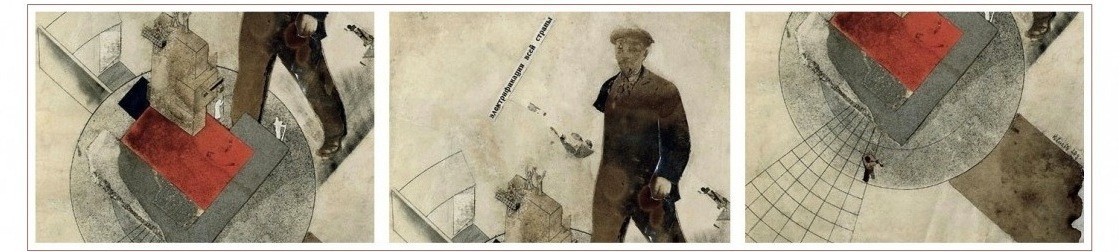Bewölkte Sichten
Kunst kommt …
Kunst ist, wenn man’s nicht kann, denn wenn man’s kann, ist’s keine Kunst.
Nestroy
„Kunst“ , das heißt, […] ein Savoir-Faire, das jedes Wissen {savoir) und jedes Machen {faire)
übersteigt.
Jean-Luc Nancy, Die Lust an der Zeichnung
Formt man mit einiger – sowohl artistischen wie artifiziellen, vor allem dilettantischen Freiheit Arnold Schönbergs insistentes, gegen einen (unter anderem Goebbels zugeschriebenen, den goldenen Boden des Handwerks feiernden) Gemeinplatz gerichtetes Verdikt, Kunst komme nicht von Können — also einer Befähigung aufgrund der normierten Anwendung von erlerntem Wissen — , sondern von Müssen — d.h. der unbezwingbaren Notwendigkeit eines objektiven Erfordernis oder eines subjektiven Begehrens, kurz: dem zwanghaften Nichtanderskönnen — taschenspielerisch ein wenig um, dann zeichnen sich möglicherweise folgende, verwickelte Varianten ab:
- Kunst kommt von Nicht-anders-können-als-können-zu-wollen (denn Können, mit Majuskel oder ohne, durch das ein Riß geht, muss sich, bevor es etwas Bestimmtes kann, zunächst einmal selbst können. Man muss können können. Und können-können können. Ad infinitum, immer im eiligen Verzug, sich selbst hinterher.). Sie kommt somit vom ein sicheres Gewußtwie exzessiv herbei ersehnenden Optativ: „Könnte ich doch können!“. Wunsch zumal, der einen unaufhörlich überkommt. Wird überhaupt etwas gekonnt, so nur das unvermeidliche Nicht-anders-können-als-nicht-zu-können-und-doch-zu-wollen-und-gar-müssen. Könnenwollemüssen ohne (anders) zu können. Darum übt sie sich – praktisch – unentwegt (aus). (Selbst im Verzicht: auch kein Künstler sein will gekonnt sein!)
- Kürzer noch und anders: Kunst kommt von Kommen. Kunst (über-) kommt. Sie entspricht einer Kunft. So gesehen kann Begabung oder Gabe (Talent, eben das, was, ohne, dass man etwas dafür kann, gegeben ist) nur darin bestehen, eine, auf gewisse Art „unfähige“, passive und passionierte Empfangsbereitschaft demgegenüber aufzuweisen, was passiert, und es durch ein Machen (gr. poiesis) zu lassen. Durch zu lassen. Eben zu geben (frz. rendre). (Ohne je sicher zu wissen, wann es letztlich GUT gewesen sein wird. Denn fertig ist es immer schon und nie.)
Vielleicht so. Forse.[1]
Let´s see what happens: Fertig-Sein
L’idée de faire une peinture ou une sculpture de la chosetelle que je la vois ne m’effleure plus. C’est comprendrepourquoi ça rate, que je veux.
Der Schweizer Maler, Bildhauer und Grafiker Alberto Giacometti (1901-1966) hat diese Grundproblematik des kunstvollen, gekonnten Wollenmüssens ohne Können zu können sein Leben und Werk lang konsequent ausgetragen, sich dem subjektiv-objektiven Ungenügen und Unvermögen mit virtuoser Insistenz gestellt. Verstehen, warum es nicht klappt („C’est comprendre pourquoi ça rate, que je veux“) war sein Motto. Und Scheitern dabei als notwendigen Zwischenschritt, wenn nicht als eigene Form des Gelingens aufzuwerten und (noch in der Trauer und im Hadern) zu bejahen ein Zug, der seine Verfahrensweise dem Existentialismus naherückte, dem er gleichwohl, ähnlich wie Beckett, sich nicht so bruchlos subsumieren lässt wie Sartres Aneignungsversuch es wollte.
Aber was sollte denn überhaupt klappen? An welchen Kriterium misst sich ein Gelingen, im Vergleich zu welcher normativen Vorgabe wäre ein Versuch als ungenügend oder gar fehlgeschlagen, schiefgegangen und gescheitert einzustufen?
„Rendre ma vision: Wiedergeben, was ich sehe“, darum ging es ihm zeitlebens, was sich als unmögliches, paradoxes Unterfangen erweisen sollte. Nicht nur, weil die Doppelbödigkeit des Begriffs vision, zugleich die empirische Sehweise und das illusorische Traumbild bezeichnend, etwas trauernd nachjagt, was sich nur zeigt, indem es sich entzieht: der Sicht, dem Sehen selbst, vor aller Konvention und Konfektionierung, vor allem Schema. Es gibt sich darüber hinaus die Sicht von dem her, was zu sehen gibt: dem Gesehenen, dem „Objekt“, dem Modell in seiner wirklichen, wahrhaftigen, lebendigen Realität. Wie das adäquat wiedergeben?
Ge-Sicht
In einer jetzt auf deutsch vorliegenden, erstmals 1991 im Original erschienenen Studie des französischen Kunsthistorikers Thierry Dufrêne werden diese Aspekte des Schaffens Giocomettis einerseits von seinem künstlerischen Werdegang aus betrachtet, der eine frühe Faszination für außereuropäische Kunst erkennen lässt, sowie einer entscheidenden Begegnung mit einer anderen „Schlüsselfigur des 20.Jahrhunderts“: Jean Genet. Welcher dem Maler und Bildhauer einen Text gewidmet hat, der für ihn stets bedeutsam bleiben sollte. Die im Zuge dieser Begegnung zweier Künstler entstandenen drei Portraits werden luzide in doppeltem Bezug auf Giacomettis wahrnehmungstheoretische Prämissen und afrikanische Masken- und Plastikenkunst hin durchleuchtet, was eine „vision“ seiner „vision“ ermöglicht, die jene Fallstudie zu einer ausnehmend instruktiven Lektüre werden lässt. Nachvollziehbar wird, neben dem erneuten Erweis der Bedeutung früher außereuropäischer Kunst für das Verfahren, vor allem eines: Die Sicht, seine „vision“, die herauszubringen ihm so wichtig war und die von einer Gegensicht, dem vom Kopf (der Haupt-Sache: „wenn man den Kopf hat, hat man alles.“) ausgehenden Blick (regard), im Deutschen das Ge-Sicht (visage) beantwortet wird, war niemals einfach leuchtend und klar, war keine Epiphanie, sondern von einer Bewölkung gezeichnet: Einer Vagheit, als welche ein sein eigenes Sehen sehen wollendes Sehen sich selbst, sich sich entziehend, sich — immer aufs Neue scheiternd — evident wird.
„Eine tiefgreifende Erzählung über das moderne Portrait in der Kunst und die Metaphysik des Gesichts.“
J’avais commencé aussi deux bustes, un petit, et, pour la première fois, je ne m’en sortais pas, je me perdais, tout m’échappait, la tête du modèle devant moi devenait comme un nuage, vague et illimité. (Giocometti)
Tillmann Reik
[1] „Beckett fordere mich auf, das Bühnenbild für Godot zu machen. Dazu brauchte es einen Baum. Einen Baum und einen Mond. Wir verbrachten die ganze Nacht im Atelier vor einem Baum aus Gips, um ihn karger zu machen, kleiner, die Zweige dünner. Es sah nie gut aus und gefiel weder ihm noch mir. Und jeder sagte immer wieder zum anderen: Vielleicht so … .(im Original: Forse).“ Zitiert nach: Manfred Milz, Samuel Beckett und Alberto Giacometti. Das Innere als Oberfläche, Würzburg 2006, S.27