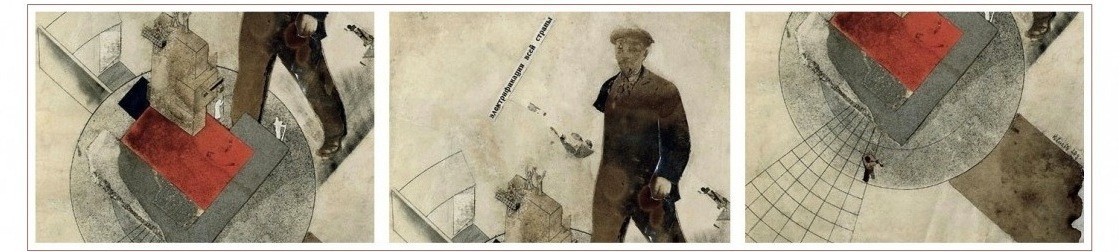Mersch de la Philosophie: Kunstgriffe denken
Im Ästhetischen gibt es Erkenntnis nur „schlagend“. (157)
Um ein anderes Denken, anderes als jenes Denken, das sich als prädikativ verknüpfende diskursive Logizität denkt oder ein Denken des Anderen zu denken, forscht Dieter Mersch im Bereich der Künste — jenen, laut seiner Darlegung, konjunktionalen Verknüpfungsarten, für die ihm in erster Linie Malerei und Musik einzustehen scheinen (denn Beispiele aus der Literatur sind rar). Er findet hierbei, in katachrestischen Konstellationen, die Sichtbarmachung — und das heißt für ihn, ein (Sich-)Zeigen, welches er klar vom Sagen getrennt sehen will — eines dem szientifischen Verständnis dieses Begriffs heterogenen Wissens, das mehr mit dem Witz (der mit dem Wissen über die Wurzel ie. *u̯eid- ‘erblicken, sehen überdies nah verwandt ist), der glücklichen, aber letztlich begrifflich nicht fixierbaren Findung, einer phronesis, aufblitzenden Evidenzen und singulären Mikrophänomenen in ihrer allem Allgemeinbegriff abholden, kontingenten und unfüglichen Diesdaheit nachspüren zu tun hat, als mit den etwas bedeutenden Aussagen und Thesen, den propositionalen Sätze innerhalb konsequenzlogischer Argumentationen philosophisch (mithin metaphysisch-ontologisch) gefasster theoria als episteme. Die Anschauung ästhetischer Erfahrung in ihrer Eigenständigkeit vor den privilegierten Dispositiven diskursiver Rationalität, das Ästhetische als Denken sui generis auszuschälen, gelingt Mersch anhand von Referenzen auf vornehmlich avantgardistische Werke und Installationen, deren Experimente und Versuchsanordnungen als Zeugen aufgerufen werden für eine “regellose Praxis” der Zer-Zeigung, bei der Zeigen sich reflexiv auf sich selbst zurückbiegt, um, außer intentional auf etwas anderes, auch und zuvörderst auf sich selbst zu zeigen: das Zeigen als solches auszustellen.
Mersch vergleicht diese mit Rekursion und Selbstreferentialität weitgehend homonymisierte, “Reflexivität” genannte Geste des Zeigens — sehr in Absetzung zu mancher argumentationslogischen Bemühung, beide Bereiche sorgsam zu scheiden — dem unendlichen regressus oder der petitio principii.
Konstellation, der Un-Fug eines Con/Com, anders als die Konfiguration nicht in eine volle Figur gerundet sowie ebensowenig nach Art Heideggers vom fügenden Fug einer Versammlung aus, sondern als eine “lose Kopplung”, ein Geflecht von Verteilungen zu denken (173) bedeutet dann, mit einem “Zusammensein” konfrontiert zu sein,
das sich noch nicht zu einer Identität oder Symbolisierung geschlossen haben muss — das aber, wo es zur Kunst wird, das Moment einer notwendigen Reflexivität inkludiert. (175)
Mersch — der auch in anderen Kontexten gelegentlich betont hat, mit Linearität komme man nicht weiter, während doch das Bestreben, weiterzukommen selbst den Vektor des Linearitätsdenken schwerlich nicht prolongiert (es sei denn, es gelänge, die Linie anders zu denken als ungeteilt)– lässt auch in dieser Studie einerseits den Eindruck entstehen, dichotomische Bifurkationen seien, selbst heuristisch, unzureichend, während er auf der anderen Seite sämtliche Befunde seiner Analysen auf eine Axiologie derartiger binärer und meist hierarchisierter Unterscheidungen — seien es auch modale, wie hier der Verknüfungsweise — stützt. Ob sich ein auf Zeige-Zeuge namens Zeichen gründendes Sagen (das im lateinischen über dicere schon semantisch ins Deiktische und Didaktische und im Deutschen zusammen mit sehen über ie. *seku̯- ‘wittern, spüren’ (vom Hund bei der Jagd) ins Jagen und verfolgende Nachstellen verwickelt ist) tatsächlich ohne weitere Verwicklungen vom Zeigen trennen lässt, selbst wenn diese Unterscheidung Wittgenstein (bei dem die beiden Terme sowohl einander ausschließen wie komplementär sind, bzw. das Zeigen einen von allem Sagen vorausgesetzten Überschuß repräsentiert: „Was gezeigt werden kann, kann nicht gesagt werden“ (TLP 4.1212) / „Der Satz zeigt, was er sagt“) und Benjamin als Zeige-Zeugen aufruft, sowie, ob diese Unterscheidung ihrerseits gezeigt oder gesagt wird, bleibt so ungesagt, wie es sich, zumindest für den Rezensenten, nicht zeigt.
Für den frühen Wittgenstein des Tractatus, dem diese Unterscheidung “Hauptproblem” der Philosophie war, scheint “sagen” immer auch soviel wie “erklären und theoretisieren” zu bedeuten; durch Propositionen vermitteltes Wissen, Aussagen über etwas, bei dem die Weise, wie gesagt wird, nicht mitgesagt werden kann, aber sich zeigt.
Funktionieren kann diese Distinktion, deren Wert darin liegt, eine gewisse Inadäquatheit der Sprache in Bezug auf sich selbst zu beleuchten, wohl nur dann, wenn Sprache mit einem Organisationsystem schlußförmig urteilender Satzformen schlechthin gleichgesetzt wird; sie nicht als die Gleichzeitigkeit dieser Formen und ihrer ständigen Deformationen, welche letztere erstere ermöglichen, gedacht wird. Dann nämlich spricht Sprache unausgesetzt von einer anderen Sprache und anderem als Sprache, zeigt sich der Wahrnehmung als solche divergente Unstimmigkeit und trägt jedem wahren logischen Satz die Male seiner Inkonsistenz ein.
Dann wäre jedoch gleichzeitig zu überlegen, ob die Unterscheidung der Modi der Prädikation und der sich selbst und ihr Zeigen ausstellenden, exponierenden Konstellation so streng durchgehalten werden können, oder ob nicht, womöglich mit Wittgenstein gegen Wittgenstein, jeder Satz im gleichen Zuge, wie er prädiziert auch sich selbst — das heisst, das in ihm Zusammengestellte — als Zeige-Zeug und deutungsloses Zeichen exponiert. Das Denken der Kunst und das der logoi wären dann nicht in distinkte Zonen zu separieren, sondern der Bereich der Wahrnehmung und Sinnlichkeit, d.h. auch der ästhetischen Erfahrung, verdeutlicht sich als — auch nicht mehr rudimentäre Vorstufe, präreflexive Denkweise sondern unverzichtbare Bedingung der Möglichkeit noch der kategorialen Schlußformen und thetischen Setzungen. Jede Prädikation, jeder Syllogismus verdankt seine Imposanz und Evidenz, die Wucht seiner Überzeugungskraft, diesem artistischen “Voilà”, das auch den Be-Griff noch als Kunstgriff erkennbar werden lässt. Die positionierende Prädikation der Kopula würde von der überschießenden, spektral streuenden Medialität des “als” (etwas als etwas zu zeigen/sagen und damit “durch” etwas zu sagen) dergestalt überflutet, dass von “Epistemologien des Ästhetischen” in Unterscheidungen von anderen, herkömmlichen Epistemologien zu sprechen, bereits keinen Sinn mehr machte, weil – vor dem Hintergrund einander imitierender Genres und Modi — niemals klar wäre, wo die Gattungsgrenze definitiv gezogen werden soll.
Tillmann Reik
Informationen zum Buch