Bezugna(h)men des Verhältnisworts – Sieben An- und Fürsprachen der Liebessprache der Sprachliebe zuliebe. Im Nachklang einer Hamacher-Lektüre
Für Alexandru Bulucz[1]
Philology, a love story (Werner Hamacher)
[…] das undurchsichtige Verhältnis zwischen philein und logos […] (Thomas Schestag)
[Das Folgende versteht sich so sehr nicht als ein beurteilendes Sprechen über das angezeigte Buch, sondern stellt, hoffentlich treffender formuliert – und eher mit, ausgehend von und eben für –, den womöglich zu enthusiastisch-ausufernden, zu affektierten[2] Niederschlag einer die Entsprechung in der Unangemessenheit suchenden mentalen Reaktion dar, deren entscheidende explizite Bezugnahmen wohl eher noch in den kommentierenden Fußnoten, zuunterst, – deren Lektüre somit unerlässlich scheint — verortet sind, als im wie gewohnt Dominanz reklamierenden Fließtext.][3]
I.
Welches Verhältnis unterhält ein Verhältnis zu einem anderen und wie, auf welche Beziehungsweise?
Die Welt der Philologie, dieses „sonderbaren Centauren“[4], ist, an und für sich[5], terminologisch[6] und vielleicht darüber hinaus[7], eine schwindelerregend seitenverkehrte.[8] Das geleitet obendrein, eröffnend, wenn auch nicht bruchlos, mitten hinein in die amourösen „logischen“ Intrikationen ihrer asketischen Exerzitien; es führt früh, first and foremost: ins „für“[9].
Als Konfixkompositum gelesen invers konstruiert – im Vergleich zur gewohnten Bauart von Gebietsbezeichnungen epistemischer Disziplinen in seiner Nahtstelle – dort, wo das eine Wort sich in zwei auftrennt – gekippt und umgewendet, darin jedoch der Philosophie/Sophophilie verwandt, mit welcher zusammen sie (und oft nur als ihre ancilla) aus dem Reigen der positiven Wissenschaften ausschert – genießt die in Rede stehende Sprach- und Literaturwissenschaft den unzweifelhaften Ruf, nicht primär als „Lehre von der Freundschaft/Liebe“ gelten zu wollen oder gar als Wissenschaft derselben; wie etwa die Biologie geradeheraus eine vom „Leben“ vorzustellen beansprucht; das Verhältnis ihrer beiden sich paarenden Wortteile zueinander ist also ein, komparativ zu den anderen Fakultäten, abweichend befremdliches.[10]
Denn sie soll demgegenüber, vice versa, so Werner Hamachers affektive Deutung[11], vor allen disparaten, desperaten Ent-sprechungen[12] jenes vieldeutigen griechischen Ur- und Unworts[13], die innige Freundschaftsliebe (φιλíα), die Zugetanheit, knapper: einen bestimmten emotionalen Bezug, ein spezifisches affektives Verhältnis zum λόγος, der seinerseits Verhältnis, Relation genannt wird, [14] benennen. Gemeint ist ein logischer Affekt in doppelter, reflexiv-transitiver Bedeutung im Sinne Friedrich Schlegels. Wieder verwirrt die Unsicherheit betreffs des richtigen Genitivs, der Herkunft und seiner Ausrichtung. („Philologie ist ein logischer Affekt, das Seitenstück der Philosophie, Enthusiasmus für chemische Erkenntnis: denn die Grammatik ist doch nur der philosophische Teil der universellen Scheidungs- und Verbindungskunst.“ Athenäums-Fragment 404).
„Philologie“, diese scheinbar „perverse“ begriffliche Torsion, fungierte demnach als gleichsam „verdrehter“ Signifikant für einen anderen; nämlich für das und zugunsten dessen, was, der „–logien-Terminologie“ und deren Logik zufolge, man könnte denken: besser und also eigentlicher, „Logophilie“ hätte heißen sollen.
Noch einmal darauf zurückkommend, denn Repetivität, todestriebgesteuerter Wiederholungszwang ist ihrem expansiven Streben offenbar zu eigen; diesmal jedoch mit bewusster aufs Präpositionale, Verhältniswörtliche gerichtetem Augenmerk, Ausrichtung auf die Gerichtetheit seiner Bewegung[15]: Affektive Hingezogenheit und Hang zu, sehnsüchtiges Verlangen nach, Anlehnung an einen, Gefallen und Mögen[16] eines λόγος, der vor ihr kam, wie er sich selbst (zu spät kommend) vorausgeht; ein prologos, von dem sie angegangen wird, und auf den unvermeidlich stets erneut zurückgekommen werden muss. Ein λόγος indessen, später unter anderem mit Verbum übersetztes Namenwort, von dem noch, – wenn man meint, annähernd zu wissen, was Liebe, was Freundschaft sei und dass die φιλíα [17] ihr entspreche – zu sagen bliebe[18], was er denn (be)sagen wolle – sein vouloir dire als solches steht aus: logos, che vuoi? – sowie auf welche Art ihm das Lieben – ob philia, eros oder apape: diese durchaus nicht unsinnliche amititia spannt als double bind sämtliche ambivalenten Aspekte der Zwiefalt einer Haßliebe auf, einer Mixtur aus Komplizität und Rivalität[19] – zustößt und welchem Objekt sie gilt. Wie hat man sich unterdessen, muss nun doch peri philía/de amititia gefragt werden, dieses „falling in love“ des λόγος, das ein failing gewesen sein wird, den Fall seines Gefallens in seinen verschiedenen Deklinationen, vorzustellen (und umgekehrt: wie stößt der philia der logos zu)?
Geschieht es durch Einwirkung von außen, per Unfall, Zufall, oder vielmehr aus seiner eigenen immanenten Beschaffenheit heraus, einem lapsus linguae der lingua, so dass das philein womöglich analytisch des logos´ Hauptattribut bestimmt, expliziert, aufdeckt, bis zu dem Punkt, an dem, wenn nicht philía und logos synonymisch deckungsgleich einander vertreten, so doch Philologie sich in Begriff und Sache als (sei´s denn, paradox, unaustilgbar oxymorontischer) Pleonasmus entblößt. Tautologie einer Autologie, die keine ist, denn Philologie ist Logos, ist – damit soll die gängigste Übersetzungsvariante erstmals zum Zug kommen: Sprache („der Güter Gefährlichstes“ Hölderlin); in ihrer diasporischen (Selbst-)Befremdung. Die (unglückliche) Liebe der Fremdsprache zu sich selbst, die im Begehren der kuppelnd-kappenden Kopula („Kappula“, Hamacher), stets neue Verknüpfungen auf dem Boden einer irreduziblen „Losigkeit“ (Beckett) zu stiften und aufzulösen (wobei eins nie ohne das andere stattfindet), ihren Niederschlag findet. Nicht überflüssig, daran wiederholt zu erinnern, Hamacher tut es: Platons die Freundschaft verhandelnder Dialog heißt Lysis: Lösung, Entbindung.
Ein logos wäre dieser Logik gemäß immer „philiatisch“ oder amourös; ein philein notwendigerweise – man denke an Roland Barthes Fragments d’un discours amoureux, die Liebe als ein diskursives und also sprachliches Geschehen entfalten – „logisch“, er wird sich in irgendeiner Sprache vernehmen lassen. Philia evoziert demzufolge das masturbatorische, phallologische Moment seiner, des logos, Auto-Affektion; mithin ihn selbst, wie er sich in dieser Selbigkeit zu ergreifen, zu fassen, zu schließen sucht:
„weil der Logos selbst schon Liebe, und zwar Liebe zur Liebe ist. Die Sprache liebt. Wer sie liebt wie der Philologe, der liebt in ihr die Liebe“ (34).
Logologie[20], so könnte kurzum eine Selbst-Befragung des Logos betitelt werden, käme sodann zuvorderst nicht umhin, im selben Zug Philophilie, die Liebe zur Liebe zu sein, Selbst- und Eigenliebe der Liebe, Autophilia und Philautia: Autologie.
…
Etwas in der Rechnung dieser reflexiven platonischen Erotologie des Bei-Sich-Seins indes geht nicht glatt, nicht restlos auf: sie bricht sich an sich und also ihrem Anderen, die erhoffte versöhnliche Rundung scheitert; ein Riß (auf den das Schreiben, übers Ritzen etymologisch zurückführt) und eine Unterbrechung des logos, der sich als autos aneignen will, ein Defekt im Affekt, ermöglichen ihn zuallerest:
„Die Selbstaffektion ist aber als philologische die Affektion des Logos durch sich, seine Selbstberühung und Selbstreizung, die ohne einen Riß in ihm nicht möglich wäre.“ (S.35)
Kein Reiz ohne Riß. Kein Reden ohne Schreiben. Keine philia ohne polemos und xenía. Kein Freunden ohne Befremden. Keine Autoaffektion ohne Heteroaffektion: philía trägt sie alle im Differential ihres Doppelnamens. In ihrem Namen wird überdies zu denken versucht, wie sich etwas ins Verhältnis setzt und Bezug nimmt: als Attraktion von Gleichem und Gleichem, wie die Redewendung es will oder doch ganz anders, heterogener, fremdartiger: Gegensätze ziehen sich an, Differenzen suchen Nähe; Inkommensurablität ohne Gleichen, jedoch inmitten von Parabeln und Gleichnissen.
II.
sprechen Vb. ‘reden’, ahd. sprehhan (8. Jh.), mhd. sprechen, asächs. sprekan, mnd. mnl. sprēken, nl. spreken, aengl. sprecan und die r- losen Formen ahd. spehhan (9. Jh.), asächs. spekan, mhd. spehten ‘schwatzen’, aengl. specan, engl. to speak ‘reden’, mnl. spēken werden wie mnd. sprāken ‘Funken sprühen’, mnl. sparken, aengl. spearcian, anord. schwed. spraka ‘knistern, prasseln’ und die unter Sprache (s. d.) genannten Formen als Schallwörter mit alban. shpreh ‘ich spreche aus’, kymr. ffreg ‘Geschwätz’ und aind. sphū́rjati ‘donnert, grollt’, griech. spharagḗīsthai (σφαραγεῖσθαι) ‘knistern, zischen, strotzen, zum Platzen voll sein’, lit. (ablautend) sprógti ‘bersten, platzen’, ohne anlautendes s- kslaw. prъžiti, pražiti ‘rösten, dörren’, russ. (älter) prjážit’ (пряжить) ‘in Butter backen’ auf ie. *(s)p(h)ereg-, *(s)p(h)erəg-, *(s)p(h)rēg- zurückgeführt, eine g- Erweiterung der unter Sporn (s. d.) genannten Wurzel ie. *sp(h)er(ə)- ‘zucken, zappeln, schnellen’ (auch ‘streuen, sprengen, spritzen’, s. sprühen, Spur).
Vielleicht gäbe das reine sich austragende „Sagenwollen“ als solches, vor aller kodifizierten Bedeutung, verliebt in sich und sein rastloses Übersichhinaus, seine unablässige Fortsetzung und endlose Erweiterung die treffenste Entsprechung jenes frühesten Grundworts der griechisch-christlichen Ontotheologie, weil sie publik macht, was logos zu sein energisch in Abrede stellt: reines, sinnfreies, uneigentliches Gerede des Phatischen zunächst, idle talk oder „la parole vide“, Parlando und Geschwätz einer logosinhärenten, ihm ebenso „wesentlichen“, nicht akzidentell zustossenden Logorrhoe: Babylonisches Gebabbel, Stimmengewirr. Zerstreuung, der antike Agora und Forum[21] öffentliche Austragungsstätte und Versammlungsort einräumen, Statt geben. Sie werden damit, und logos als Ganzer mit ihnen, zum rätselhaften Paradox einer disseminativen, distributiven Mit-Teilung, die sich zu sammeln, bewahren und bewähren versucht, aber als Zerstreuung, ohne diese dabei preiszugeben. Im Anfang war Logorrhoe und Glossolalie. Nichtssagendes Sagen. Auch und vor allem: im lautlosen „Geläut der Stille“ einer Schrift.
III.
Nach vorherrschender Übereinkunft der institutionell konsolidierten Wissensdisziplin Philologie wird zur Selbstbeschreibung bekanntermaßen derartiger bislang unter Beweis gestellter Übermut, ein außer Rand und Band geratener furor philologicus, nicht nur nicht aufgeboten, sondern wohl gar dezidiert vermieden. Logos wird hier meist schlicht als Sprache verstanden, dabei vorausgesetzt, das sei selbsterklärend und diese ein bestimmbarer homogener, abgrenzbarer Bestand, den sich ein Aristolisches zoon logon echon als Habe und Besitztum auf sein Konto verbuchen könne.[22] Hamachers These 19 bestimmt ihn, den Menschen, demgegenüber als zoon logon euchomenon, das nach einer Sprache (die selbst zunächst, vor allem wahr/falsch apophantischer Aussagen, nichts als euché, Wunsch, Gebet, Verlangen ist) verlangt, sie, die er ersehnt und die sich verspricht somit nicht hat; und als zoon philologon.
Weder werden der eingeschliffenen Routine nach die Faustschen Näherungsversuche an den, den logos, Christus und die Liebe ineinssetzenden Johannesprolog (nach anfänglich geringschätzender Verwerfung des „Worts“, mit dem er sich nicht lang aufhält) „Sinn“, „Kraft“ und die präferierte „Tat“ herangezogen, die dann als Theorem von der Performanz der Sprache als bloß einer ihrer Aspekte erst nachträglich eingeschmuggelt wird. Noch wagt man bis auf Weiteres, sich in selber wohl bereits zu performative Heideggersche Verstiegenheiten wie die von der sehen und vorliegen lassenden „legenden Lese“ oder der schon angedeuteten, logos könne schlicht „die zeigende Sage“ sagen und damit, gar nicht mehr so schlicht, das ganze (traditionell vornehmlich visuell aufgefasste) sich nach Aristotles auf multiple Weise (pollakos legomenon) äußernde Geschrei des Seins, eingelassen. Doch kann man dem Umstand aus dem Weg gehen, dass nicht nur der logos sich vielsagend („alogisch“ und selbst-widersprüchlich) äußert, sondern dass demgemäß auch über und von ihm multiple Gerüchte kursieren, denen Gehör zu leihen, in die sich einzuhören wäre, auch wenn alles in der Totenstille der Schrift sich zuträgt?
IV.
UND WIE DIE GEWALT
Entwaltet, um
zu wirken:
Gegenbilderts im
Hier, es entwortet im Für,
Myschkin
küßt dem Baal-Schem
den Saum seiner Mantel-
Andacht,
ein Fernrohr
rezipiert
eine Lupe.
Das frühe Wort λόγος als Wort für das Sagen und zugleich für das Sein fasst Heidegger an einer Stelle folgendermaßen:
„Das älteste Wort für das so gedachte Walten[23] des Wortes, für das Sagen, heißt Λόγος: die Sage, die zeigend Seiendes in sein es ist erscheinen läßt. Das selbe Wort Λόγος ist aber als Wort für das Sagen zugleich das Wort für das Sein, d. h. für das Anwesen des Anwesenden. Sage und Sein, Wort und Ding gehören in einer verhüllten, kaum bedachten und unausdenkbaren Weise zueinander.“[Hervorhebungen, bis auf es ist, von mir][24]
Demgemäß, aber subversiver verschoben, versteht sich ebenso für Werner Hamacher Philologie, in Auslegung eines nachgelassenen Gedichts von Paul Celan, als befreundende „Fürsprache für die Sprache und ihr für“. Logos entpuppt sich auf diese Weise gewendet nicht nur als das Wort für das Sagen; er ist (d.h.: stellt, setzt, lässt vorliegen:) das Wort für das freundlich-befremdliche Für. Philologie in Hamachers Verstand legt reflexiv für das Verhältnis- oder Vor- (nicht Für-)-Wort „für“ ein Wort ein (75); für ein als „antwortend-entwortendes Gegenwort“ bestimmtes für. Sie ist „pro logos“ fernerhin in ihrem immer nachträglich einsetzenden Epilogen, und noch dort, wo sie contra auftritt und „la parole“ Paroli bietet, kann sie dem, was abgelehnt wird immerhin nur parieren, indem sie es als sprachliches Phänomen (und hieße das vielleicht wirklich – versteht man Sprache allgemein als ein differenzielles Verweisungssystem, zu dem genauso Bilder zählen – Phänomen schlechthin?[25]) und von ihm affiziert, rückhaltlos affirmiert. (Was auf eine Affirmation hindeutet, die noch philia, eros und agape übersteigt, oder sie ermöglicht). Sodann etwas supplementär bei- und zufügt: addiert, doch zudem, durch diese Erweiterung eines niemals festen Bestands, zufügt, wie man es von einer Intervention behauptet, die durchaus als leidhaft erfahren werden kann: das Beifügen einer Verletzung. Man mag sich ans Ende der Apokalypse, der Offenbarung des Johannes erinnert fühlen, wo, als Zusatz, after all is said and done, der, welcher die Weissagung dieses Buches (das im Ganzen das Buch der Bücher beschließt) bewahrt, selig gesprochen und aufgefordert wird, das überall sich ankündigende Kommen („Siehe, ich komme bald.“) mit einem sich empfänglich zeigenden Einladungsgruß („Komm! Und wer es hört, der spreche: Komm!) zu beantworten, gegenzuzeichnen, ergänzen. Es folgt eine letzte (vorletzte) Beifügung, die alle Beifügung, alle Veränderung, allen Zusatz verbietet und unter Strafandrohung stellt: der welcher beifüge, dem werde Gott, gleichsam talionisch, Gleiches mit Gleichem vergeltend, etwas beifügen: Plagen. („JCH bezeuge aber alle / die da hören die wort der Weissagung in diesem Buch / So jemand dazu setzet / So wird Gott zusetzen auff jn die Plagen / die in diesem Buch geschrieben stehet.“ Off 22,18).
V.
Vieles übrigens von dem bis jetzt Kundgetanen schreibt Hamacher wohlverstanden (so) nicht, es fügt sich ihm in gesagtem Sinne zu, womöglich zu seinem Leidwesen. Obgleich nämlich seine Befragung der Philologie, die sich zeitweilig als Frage nach der Frage (und diese sowohl genuin innerphilologische wie aus einem Außen ihr zugeneigte philophilologische sei) – was ist eine Frage? – ausgibt, ihr wohlgesonnen und hold, wenn nicht verfallen ist, betont er, wie schon bemerkt, ausdrücklich die diesem Pathos, dieser passio innewohnende Ambivalenz: Philologie (ihrerseits Pathologie) ist immer zugleich Misologie (man müsste ergänzen: Logophobie), insofern als logos und polemos (auch das hatte Heideggers Philopolemologie, jedenfalls in Kriegszeiten, seinerseits betont) dasselbe, die Zusammenstellung von der Auseindersetzung (nach Celan zusammen-, nicht „auseinandergeschrieben“) Eros von Eris, dem Zwist, nicht zu trennen sind.
„Die Auseinandersetzung [Auseinandersetzung* ist die von Heidegger autorisierte Übersetzung für polemos] trennt weder, noch zerstört sie gar die Einheit. Sie bildet diese, ist Sammlung* (logs). Polemos und Logos sind dasselbe.” (Einführung in die Metaphysik)
Weil eine immanente Polemik, im Sinne Schlegels, Sprache derart fort-setz als sie sie von sich selbst ent-fernt, auf Distanz bringt, eben, wie es ein weiterer verräumlichender und eine zeitliche Folge bezeichnender Gebrauch des für markiert, Zeichen für Zeichen, Schritt für Schritt auseinandersetzt, parodisch persifliert und in permanenter Parekbase zum Selbst-Austritt veranlasst, ist sie uneins mit sich und so muss es die ihr zugetane Philologie nicht minder sein.
VI.
Übermeister,/du unterst/nach oben (Celan)
Für, per, pro, prä und ad, „an und für Anderes“ in seiner gleichsam tranzendentalen Präpositionalität firmiert somit als Hamachers Übersetzung jener „freundenden“ philía, Affirmation, die Heidegger im Herklit-Seminar, jovial und generös, gönnerhaft, mit der Gunst und dem Gönnen, dem Gewähren übersetzt hat. Ein Für, dessen eine wichtige Bedeutung trotzdem, aber bescheidener a-nominal-präpositional, neben dem substitutiven „anstelle von“, „zugunsten“, also „pro“ und „zuliebe“ lautet.
Vier Funktionen des modal, kausal oder temporalen Bezugssinns der Für-Struktur (die somit der „Als-Struktur des Verstehens“ Heideggers sich beigesellt) führt Hamacher selbst an: Substitution, zugunsten, Transzendenz und Entwortung. Im Falle etwas eines Medikaments, eines Pharmakons (und welches Zeichen wäre keins?), kann „für“ „gegen“ bedeuten. Es ist das den Primat des Logos aus ihm selbst heraus sprengende Gegen-Wort en arche, das nicht nur einem Wort ein anderes, kontradiktorisches opponiert, sondern etwas anderes als ein Wort antwortet und also, mit einem Ausdruck Celans aus einem von Benjamin inspirierten Gedicht: entwortet. Ein Anderes, das im Wort gleichwohl vorhanden ist, es öffnet: aufs Draußen anderer Wörter und aufs Wortandere.
VII.
„Ich wollte sagen, die Philologie setzt einen vornehmen Glauben voraus, – dass zu Gunsten einiger Weniger, die immer „kommen werden“ und nicht da sind, eine sehr grosse Menge von peinlicher, selbst unsauberer Arbeit voraus abzuthun sei: es ist Alles Arbeit in usum Delphinorum. (Nietzsche)[26]
Hamacher Sätze setzen, stellen, legen (ein, aus, ab, zu, etc.; vor allem jedoch: frei. Und das im Sinne einer Ent-Bindung, die in Platons Titel „Lysis, e peri philias“ Zuneigung an vorgängige Trennung koppelt). Sein, nicht nur in den nach reformatorischem Protest klingenden 95 Thesen, hyperthetisches, apophantisches Schreiben produziert prädikative, präpositionale Aussagen in Serie und proliferierender Abundanz. Nirgends allerdings erweist sich schlagender die gleichsam „logische“ Richtigkeit des Adornoschen Diktums, einzig mit Begriffen (von denen jeder einen Satz, eine death sentence und ein tödliches Urteil abgeben kann) sei über diese und ihre kategorisierende Identifikationswut hinauszugelangen[27] als in der entsetzenden, enteignenden Spreng- und Sprungkraft[28] solchen Hyper- und damit A- und Transattributismus´, der, indem er überbestimmt, immer auch um- und unbestimmt: unterminiert und indefiniert.
Um sie mit philologischer Redlichkeit so exakt wie möglich zu bestimmen, muss er ihr immer neues und anderes prädizieren: Philologie sei dies, sei jenes, ein anderes und noch eins und etliches Weitere; in letzter Instanz vor allem: ihr Anderes. Dem Einwand, solcher, bei aller Nüchternheit ausufernden, überdeterminierenden und nicht zuletzt paradoxen Omni-Prädikation würde sie — wenn ihr nach einer unendlichen Reihe von Bestimmungen zugesprochen gewesen sein wird, fast alles zu sein – zu nichts zerfallen und als Untersuchungsgegenstand entgleiten, mag Hamacher gelassen begegnen. Sollte der Titel Minima Philologica etwas anderes im Sinn haben als die Aporetizität zu erweisen, Philologie sei, als heterophiler Affekt wenn nicht ganz nichts, dann doch wenigstens fast; mit dem Infinitesimalen auch ihrer selbst befasst? Nichts als bloß der bezuglose Bezug eines für – unausrichtbar non-intentional, eher attentional – bar jeder weitereren Bestimmung und allein deshalb ihrer selbst wie der Sprache – und ihrer untilgbaren Unstimmigkeiten — unendlich bedürftig. Zu lernen geben, was gut lesen sei – Philologie zuallerst als Liebe zum Lesen verstehen – das könnte die Lektion dieser Lektüre sein.
Dann allerdings vermag die zunächst verworfene Lesart des Namens Philologie doch noch an Relevanz zu gewinnen: Aufs Detail und die Nuance versessene, sich einer Liebessprache bedienende Sprachliebe läuft in ihrer Konsequzenz auf nichts anderes hinaus als eine ethisch verstandene Freundschaftslehre in asketischer Kargheit: Einlassung und –lesung ins gemäße Verhältnis einem „Bezug zum Bezug“ gegenüber, unter der Voraussetzung, dass kein Maß dafür vorgegeben sein kann.
Tillmann Reik
Link zur Verlagsseite des Buches
[1] „Die P[hilologie] in diesem Sinne wurde in Alexandria begründet.“(http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Meyers&lemid=IP04577). Natürlich steht über Alexandria und seine brennende Bibliothek hinaus (sowie Chars Gedicht La bibliothèque est en feu: ein feu das Hamacher als eine Gestalt des für liest) auch Alexander selbst, Bukephalos sein Pferd und Kafka („Wir haben einen neuen Advokaten“) mit der Lektüre der Gesetzbücher, also der Alexandriner als Alektisches, A-Lexis, assoziativ und allusiv, im Raum. Nicht zuletzt: die Hamachersche Wortprägung der Veranderung: Allesanders. (Wolkig). „Und Alexandre zu Alessandre, das – für deutsche Ohren – von einem kaum verschliffnen Imperativ durchlaufen wird: Les andre! Alles andre! Alles anders.“ (Thomas Schestag, Parerga, S.179.) Zur mäandernden Geschichte der vereinzelt auftauchenden „Veranderung“ danke ich Ingo Ebener herzlich für den wertvollen Hinweis, dabei handle es sich um einen im Grunde Husserlschen Begriff, den Werner Hamacher von Michael Theunissen übernommen habe. Betont dieser noch in der ersten Auflage seines Buches „Der Andere: Studien zur Sozialontologie der Gegenwart“: „Husserl gebraucht diesen Begriff m.W. nicht, wohl aber bedeutungsgleiche Begriffe“ (ebenda, S.84), so stellt die erweiterte Neuauflage fest: „Die grundlegende Husserl-Deutung selber muß heute natürlich anhand der inzwischen veröffentlichten Texte zur Phänomenologie der Intersubjektivität überprüft werden. Daß sie eine solche Überprüfung nicht zu scheuen braucht, entnehme ich der Tatsache, daß Husserl – was mir bei der Niederschrift des Buches unbekannt war – den Begriff der ‚Veranderung‘, den ich als wichtiges Interpretament benutze, selber verwendet.“ (XIII) Theunissen bedankt sich in der dazugehörigen Fußnote für den Hinweis bei Dr. Karl Schuhmann und folgende Manuskripte aus dem Jahre 1935 (B I 15/22b, K III 9/13a, K III 9/14a).
[2] Als Liebender sprechen [das Folgende wird zu bedenken geben, inwiefern vielleicht nicht anders gesprochen werden kann] heißt ohne Ziel, ohne Krise verausgaben; heißt eine Beziehung ohne Orgasmus praktizieren. Vielleicht gibt es die literarische Form dieses coitus reservatus: das ist der geschraubte Stil der Galanterie. (Roland Barthes, Fragmente einer Sprache der Liebe)
[3] Zitiert wird vorzugsweise aus den im Urs Engeler Verlag erschienen deutschen Ausgaben von „95 Thesen zur Philologie“ und „Für – die Philologie“, die inzwischen vergriffen sind. Der angekündigte Band enthält beide Texte in englischer Übersetzung.
[4] So Friedrich Nietzsche in seiner Basler Antrittsvorlesung.
[5] Die transformative Veranderung Hamachers vom hegelianischen Gebrauch dieser Wendung — als aufhebende Synthese der Spaltung der Welt in fusionierender Zusammstellung der Gegensätze durch den spekulativen Geist — in Hamachers Prägung eines als Aporie sich öffnenden „An-und-Für-Anderes“, mag die Logik des folgenden durchwalten. Vgl.: „Sie ist die Bewegung eines An-und-Für-Anderes, die, als Revers der Erfahrung des An-und-Für-Sich im Hegelschen absoluten, die Bewegung einer absoluten Sprache und ihrer Absolvenz von sich durchläuft.“ (Für die Philologie, S.71).
[6] Den (selbst)-unterminierenden Aspekt der Logik des logos herauszustreichen, könnte versuchsweise gleich zu Anfang als ein Hauptanliegen Hamachers definiert werden.
[7] Inwiefern sie selbst mit dem „Darüber-hinaus“ in Verbindung steht, siehe Hamachers These 4: „Sprechen können heißt über alles Gesprochene hinaus und heißt nie genug sprechen können. Der Agent jenes Darüber-hinaus und dieses Nie-genug ist die Philologie. Philologie: Transzendieren ohne Transzendenz.“
[8] Angespielt auf und auf die Philologie gemünzt wird ersichtlich Hegels bekannte Äußerung: „Die Philosophie ist ihrer Natur nach etwas Esoterisches, für sich weder für den Pöbel gemacht noch einer Zubereitung für den Pöbel fähig; sie ist nur dadurch Philosophie, daß sie dem Verstande und damit noch mehr dem gesunden Menschenverstande, worunter man die lokale und temporäre Beschränktheit eines Geschlechts der Menschen versteht, gerade entgegengesetzt ist; im Verhältnis zu diesem ist an und für sich [!] die Welt der Philosophie eine verkehrte Welt“ (SW 1, 185).
[9] Zu dessen, wie immer, abenteuerlicher Etymologie neben früh auch il principe, der Fürst, der First und das englische first führen (da für gleichwohl vor bedeuten kann, was den Fürst zum Vordersten und somit ersten werden werden lässt), siehe unten.
[10] Deviantes Befremden, xenia, wie auch das wundernde Staunen, thaumazein, liegt vielleicht im Grunde jedes Befreundens und seiner Hinneigungsbewegung; wie das clinamen des Lukrez steht es mit einem Zusammenstoß in Verbindung und bringt von der vorgezeichneten Bahn ab.
[11] Vgl. etwa These 9, die das Sprechen der Philologie der euché zuordnet und über diese dann „philiatisch“ bestimmt: „Ihr Name besagt nicht Wissen vom logos – der Rede, Sprache oder Kungabe –, sondern: Zuneigung, Freundschaft, Liebe zu ihm.“
[12] Ent-Sprechung so zu hören wie Hamacher es tut, als aussetzende Absolvenz des Sprechens durchs Sprechen, bringt bereits die erste Unwucht in jeden Versuch einer logisch konsistenten Beweisführung, die sich die Vermeidung der Widersprüchlichkeit zum obersten Ziel gesetzt hätte.
[13] Ob ein Wort, das unter anderem „Wort“ bedeutet noch oder schon eins ist? Nicht nur, ob „Wort“ noch oder schon ein Wort ist, sondern ob alle Wörter, auch die anderen, bloß Wörter sind oder stets mehr oder weniger, steht letztlich zur Debatte.
[14] Wenn eine der möglichen Übersetzungsvarianten, welche ihn der ratio annähert, ihrerseits „Verhältnis“ lautet, dann wäre philologia als „Verhältnis zum Verhältnis“ eine weitere der heterotautologischen Syntagmen, die sich in der Folge häufen werden: Selbst-Referenz eines „An und für Sich“, dass sich als „An und für Anderes“ (Hamacher) übersteigt. Hinzu kommt, dass die zur Prominenz verholfene Präposition „für“ ein Verhältniswort ist. Vgl. auch Heideggers Übersetzung im Heraklit Seminar, die logos als Bezug begreift.
[15] „Die Philologie ist in dem Maße, in dem sie Fortsetzung und Entfaltung ist, Wiederholung“ (Für die Philologie, S.77)
[16] Zur philía als ein „lassendes Mögen“ und „Seinlassen“ gelesen, siehe Stefan Lorenzer Text „Notiz über das Lassen“, in: Aris Fioretos (Hg.): Babel. Festschrift für Werner Hamacher, Basel 2009, S.281-289.
[17] Einer vor allem Wolfgang Schadewaldt zugeschrieben Etymologie zufolge soll das philein zunächst ein Aneignen bezeichnet haben und so auch bei Homer possesiv gebraucht worden sein: meine Hand, meine Frau; philos somit das, was mir nah und teuer ist. Diese Ausdeutung, die unter anderem das englische to like – ein mögen, was mag, weil es im ungleichen Gleiches erkennt oder Ungleiches angleicht (so auch Adornos „Liebe ist die Fähigkeit, Ähnliches an Unähnlichem wahrzunehmen.“) – nahelegt, wird allerdings von einer gegenstrebigen Tendenz aufgebrochen, die der bemächtigenden, gleichmachenden Aneignungsbewegung ihren sie überhaupt erst ermöglichenden Widerpart zugesellt, eine verandernde Ent-Eignung des Selbst: mögen heisst dann, gern so sein wollen, wie der/das Andere. Benveniste etwa hebt den genannten Verwendungssinn ebenfalls hervor, betont aber in der philía die Gastfreundschaft einem xenos gegenüber stärker, was eine asymmetrische Drift in ein auf Äquivalenz, Egalitarismus, Reziprozität (die Aristotelische isometes als Anwendungsfall seiner mesotes-Lehre) zielendes Konzept einläßt. Von hier aus wäre das „mimetische Vermögen“ Walter Benjamins, verstanden als der archaische, gewaltige Zwang, ähnlich zu werden (anderem eher als einem nicht verfügbaren Selbst) in seiner Befremdlichkeit neu zu inspizieren. „Die Gabe, Ähnlichkeiten zu erkennen, ist ja nichts als ein schwaches Überbleibsel des alten Zwangs, ähnlich zu werden und sich zu verhalten.“ (Walter Benjamin: GS, IV/1, 261). „Ist der Freund der selbe oder der andere?“ (vgl. dazu wie zur philía insgesamt und zum Denken einer „aimance“ als Drittes gegenüber der Unterscheidung Liebe/Freundschaft: J.Derrida, Politik der Freundschaft, Frankfurt am Main 2000. Zitat S.21).
[18] Das Zu-Sagen-Bleibende, das, nach Hölderlin, die Dichter stiften (und Dichtung laut These 14 die prima philologia) ist somit auch den Philologen aufgeben. Heißt, denjenigen, die sprechen. These 21: „Philologie ist die Passion derjenigen, die sprechen.“
[19] Dem temperiertena, auf Reziprozität gründenden Gewogensein der Freundesliebe eine spezifische Differenz einzuschreiben gegenüber dem unersättlichen sinnlichen Begehren eines Eros (der nach Freuds Platon-Paraphrase immer größere Einheiten zusammenfassen will), darum war es den einschlägigen Freundschaftsdiskursen der Tradition vielleicht zu tun. Hamacher philia ist dessen ungeachtet von Anbeginn heißblütig, zeigt von einer konstitutiven Assymetrie und lässt erahnen, das, was einander zuneigt, mag es auch das Selbe sein, zunächst verschieden und voneinander getrennt, sich anders und fremd sein muss.
Agape in ihrer jesuanischen Radikalisierung zur feindesliebenden Für-Sorge, markiert auf andere Weise die Öffnung von der Aneigungsbewegung zur Veranderung. Siehe Fußnote 2.
[20] Siehe These 9: „The portiono of philia in this appellation was forgotten early on, so that philology was increasingly understood as logology, the study of language, erudi-tion,and finally as the scientific method of dealing with linguistic,in particular literary, documents. Still,philology has remained the movement that, even before the language of knowledge,awakens the wish for it and preserves within cognition the claim of that which remains to be cognized.“
[21] Das Forum (man denke auch an das Blanchotsche, mit der gleichzeitig tötenden und das Tote auferstehenlassenden Benennkraft der Sprache assoziierte „Lazarus, venis foras“) unterhält zum Für mehr oder weniger direkte Verbindungen: Vgl. Hamachers übersetzerische Vorbemerkung zu Derridas Vorwort zu: Nicolas Abraham und Maria Torok, Kryptonymie – Das Verbarium des Wolfsmannes, Frankfurt a.M. 1979.
[22] Zur Auffassung des Menschen als eines Tiers das Sprache HAT: vgl. etwa These 6.
[23] Ans Heideggersche Walten, dessen bevorzugte Übersetzung der physis die syno-metonymische Kette logos (und dessen Angleichung an philia und polemos), moira, aletheia ergänzt, schließt sich die Waltende Gewalt Walter Benjamins an und die hier besonders mitzuhörende aus Celans Nachlassgedicht: UND DIE GEWALT/entwaltet, um/zu wirken.
[24] „Denn mit das Früheste, was durch das abendländische Denken ins Wort gelangt, ist das Verhältnis von Ding und Wort, und zwar in der Gestalt des Verhältnisses von Sein und Sagen. Dieses Verhältnis überfällt das Denken so bestürzend, daß es sich in einem einzigen Wort ansagt. Es lautet: λόγος. Dieses Wort spricht in einem zumal als der Name für das Sein und für das Sagen.“ (GA 12, S.174)
[25] Der bereits zu Anfang sich einstellenden Frage, ob es über die „Welt der Philologie“ heraus eine andere geben kann, ob Welt nicht erstlos eine der Sprache , „Sprache für Sprache“ oder „Fürsprache für Sprache“ sei, lässt sich begegnen mit der Ahnung, es müsse neben immer „anderen Sprachen auch etwas „anderes als Sprache“ möglich sein. Wenn möglich, dann allerdings als Unmögliches und dadurch Ermöglichendes.
[26] Dieser, schöner noch, Hamacher übernimmt es in seine 62. These: „Philologie nämlich ist jene ehrwürdige Kunst, welche von ihrem Verehrer vor Allem Eins heischt, bei Seite gehn, sich Zeit lassen, still werden, langsam werden –, als eine Goldschmiedekunst und -kennerschaft des Wortes, die lauter feine vorsichtige Arbeit abzuthun hat und Nichts erreicht, wenn sie es nicht lento erreicht. Gerade damit aber ist sie heute nöthiger als je, gerade dadurch zieht sie und bezaubert sie uns am stärksten, mitten in einem Zeitalter der „Arbeit“, will sagen: der Hast, der unanständigen und schwitzenden Eilfertigkeit, das mit Allem gleich „fertig werden“ will, auch mit jedem alten und neuen Buche: – sie selbst wird nicht so leicht irgend womit fertig, sie lehrt gut lesen, das heisst langsam, tief, rück- und vorsichtig, mit Hintergedanken, mit offen gelassenen Thüren, mit zarten Fingern und Augen lesen… Meine geduldigen Freunde, dies Buch wünscht sich nur vollkommene Leser und Philologen: lernt mich gut lesen“(Nietzsche, Morgenröte)
[27] „über den Begriff durch den Begriff hinausgelangen.“ (TW Adorno, Negative Dialektik, S.27)
[28] Ein Satz ist eben auch ein Sprung: „Der Satz vom Grund ist ein »Satz« in dem ausgezeichneten Sinne, daß er ein Sprung ist. Unsere Sprache kennt die Redeweise: Er war mit einem Satz, d. h. mit einem jähen Sprung zur Tür hinaus.“ (Martin Heidegger, Der Satz vom Grund, S.79-80). Hamacher demonstriert, wie Sprache, das „Haus des Seins“, ihr Bei-Sich-Sein immer wieder, über die Schwelle zur Tür hinaus springend, flüchtet. (Überdies: ein Sprung ist auch ein Riß. Die Etymologien von „Sprache“ und „Sprung“ begegnen sich, über „Sporn“ und „Spur“, in der Wurzel ie. *sp(h)er(ə)- ‘zucken, zappeln, schnellen.)
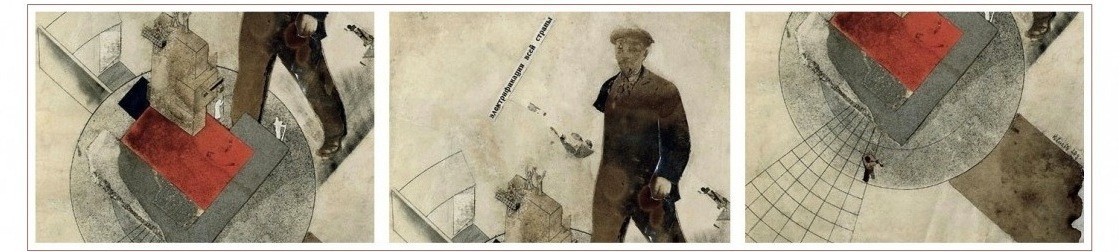



![Dürer_-_Selbstbildnis_im_Pelzrock_-_Alte_Pinakothek[1]](https://fichue.files.wordpress.com/2015/08/dc3bcrer_-_selbstbildnis_im_pelzrock_-_alte_pinakothek1.jpg?w=217&h=300)
